Der Elitebegriff gehört in der Soziologie wohl zu den kontroversesten. Das mag insbesondere mit seiner polemisch-kritischen Note zu tun haben, die häufig zu seinem objekten Beschreibungs- und Erklärungsgehalt hinzutritt. Peter Waldmann, der jüngst sein Buch über Elitenbildung im kulturellen und historischen Vergleich bei Velbrück Wissenschaft veröffentlich hat, skizziert im Velbrück Magazin gängige Ansätze in der Elitentheorie und stellt einen eigenen, auf den Charakter der Eliteanwärter fokussierten Ansatz vor.

Peter Waldmann
Zum Elitebegriff
Macht oder Charakter
Der Elitenbegriff tauchte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der politischen Diskussion auf. Er war von Anfang an stark wertbeladen und von Emotionen belastet. Miteinander im Konflikt liegende Gruppen und Schichten rivalisierten in ihrem Bestreben, ihn für ihr politischen Ambitionen zu instrumentalisieren.
Den Anfang machte die zu jener Zeit aufkommende Bourgeoisie. Sie berief sich in ihrem Aufstiegsehrgeiz auf ihre Tüchtigkeit und ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Fortschritt, um sich vom Adel abzuheben, dessen Lebensinhalt sich angeblich in eitler Repräsentation und zweckfreier Zerstreuung erschöpfte. Die bekannte Parabel des utopischen Sozialisten Henri de Saint-Simon, man sollte sich vorstellen, wie gering der Schaden für Frankreich ausfiele, wenn es mit einem Schlage seine Herzöge, Staatsminister mit oder ohne Geschäftsbereich, Kardinäle, Präfekten, Großoffiziere der Krone und sonstigen Würdenträger verlöre, und dies mit der Katastrophe vergleichen, wenn es ebenso plötzlich die besten Chemiker und Biologen, die fünfzig einflussreichsten Bankiers, Ingenieure, Baumwollfabrikanten, Schriftsteller und Gelehrten einbüßen würde, brachte die vom Bürgertum entfachte Polemik gut auf den Punkt.
Gegen diese Differenzierung wendete sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die anschwellende demokratische Bewegung die vornehmlich in Italien Fuß fassende realistische oder machiavellistische Schule (V. Pareto, G. Mosca, R. Michels). Sie argumentierte, unabhängig vom formalen Staatsaufbau werde die Macht stets von einer kleinen, der restlichen Bevölkerung an Begabung, Weitsicht, Erbcharisma und sonstigen Führungsqualitäten überlegenen Minderheit ausgeübt. Diese Sichtweise ging als »ehernes Gesetz der Oligarchie« in die Wissenschaftsgeschichte ein. Sie erfuhr in der ersten Hälfte der 20. Jahrhunderts lebhaften Zuspruch durch die faschistischen Bewegungen, der aber nach der Niederlage der Achsenmächte in eine nicht minder entschiedene Ablehnung dieses Standpunktes umschlug.
Trotzdem wollte man nach 1945 im Zuge der zunehmenden Ausbreitung demokratischer Verhältnisse als politisches Leitbild auf den Elitegedanken nicht ganz verzichten. Zum einen, weil sich ungeachtet des Bekenntnisses zum Prinzip politischer Gleichheit das Fortbestehen eines hierarchischen Gefälles auch in demokratisch verfassten Gesellschaften nicht leugnen ließ. Ein zweiter Grund hing mit dem ob seiner Erklärungskraft der primär deskriptiven Elitetheorie überlegenen marxistischen Klassenansatz zusammen. Dieser stieß aufgrund seiner primär auf die wirtschaftlichen Entwicklungen abstellenden Grundprämissen in Gesellschaften, in denen sich die Führungsgruppen zunehmend aus dem politischen Bereich rekrutierten, an seine Grenzen.
Der Elitebegriff blieb umstritten; gleichwohl schälte sich ein Konsens hinsichtlich dreier zentraler Merkmale heraus. Erstens war man sich einig, dass Eliten stets Minderheiten in Bezug auf eine soziale Grundgesamtheit darstellen. In modernen Nationalstaaten beziffert man sie insgesamt auf 2000–5000 Personen (zum engeren elitären Kreis gehören aber oft nur einige hundert). Auch auf einer tieferen gesellschaftlichen oder politischen Ebene, etwa einer Kleinstadt oder einem renommierten Sportclub, ist es regelmäßig nur einer begrenzte Gruppe, der das Attribut »elitär« zuerkannt wird.
Zweitens ist unstrittig, dass der Elitestatus der Bestätigung und Anerkennung durch ein breites soziales Umfeld bedarf. Es reicht nicht aus, dass man sich als Einzelner elitär gebärdet und der Anspruch, über der breiten Masse zu stehen, vom engen Freundeskreis akzeptiert wird; oder dass jemand im Internet eine Gesinnungsgemeinschaft begründet, die ihre Erlöserbotschaften als allgemeingültig hinstellt. Die Anerkennung muss freiwillig erfolgen und über unterschiedliche soziale Segmente und Gruppen streuen. Politikwissenschaftler schrauben oft das Anspruchsniveau noch höher, indem sie von Eliteanwärtern verlangen, dass sie für die jeweilige Bezugsgruppe relevante Entscheidungen mitformen und beeinflussen. Das geht aus meiner Sicht zu weit, knüpft zu eng an den Machtaspekt an, gegen dessen Verabsolutierung, wie noch zu zeigen sein wird, ich mich gerade wehre. Das Kriterium der Anerkennung ist ausreichend, da es die soziale Rückbindung und minimale Verankerung der Eliten in einem breiteren Umfeld verbürgt. Auf welchen Qualifikationsmerkmalen die soziale Wertschätzung beruht, ist zunächst zweitrangig, für eine Elitenanwartschaft kommen ganz unterschiedliche Bereiche wie Wirtschaft, Religion, Kunst, natürlich auch Politik in Frage. Wichtig ist nur, innerhalb des für die Unterstützung erforderlichen Publikums zwei Teilgruppen auseinander zu halten: zum einen die Öffentlichkeit im Allgemeinen und zum anderen bereits etablierte Mitglieder der anvisierten gehobenen Statusgruppe. Ihre Akzeptanzkriterien und Erwartungshaltungen können stark differieren
Ein drittes, ungeteilte Zustimmung findendes Merkmal ist schließlich, dass der Aufnahme in eine Elite ein Auswahlprozess zugrunde liegen muss. »Elite« leitet sich etymologisch aus dem lateinischen eligere und dem französischen élire, d.h. auswählen, her. Im 17. Jahrhundert auf Waren bezogen und im 18. Jahrhundert auf militärisch sich auszeichnende Einheiten übertragen, wurde der Begriff im 19. Jahrhundert zunächst in England und Frankreich, dann auch in Deutschland in den sozialen Sprachschatz aufgenommen. Ihm zugrunde lag der Wettbewerbsgedanke. Nur jene, die sich im allgemeinen Konkurrenzkampf behaupteten und deshalb besonderes Prestige genießen würden, verdienten es, als elitär eingestuft zu werden. Dabei war man sich in jüngerer Zeit durchaus dessen bewusst, dass Verdienst und Erfolg auseinanderfallen können und vor allem ein realitätsverzerrender Effekt von den Medien ausgehe. Unabhängig davon hat sich beim Gros der Bürger in den westlichen Gesellschaften doch die allgemeine Überzeugung gehalten, im Großen und Ganzen beurteilen zu können, wer das Eliteetikett verdient, wer nicht.
Bewusst stelle ich »das Gros der Bürger« ins Zentrum meiner Überlegungen, denn die wissenschaftliche Diskussion bewegt sich, jenseits der Einigung auf die drei herausgestellten Grundprinzipien, in den letzten Jahrzehnte in einer Richtung, die man wohlwollend als einseitig, schärfer dagegen als verfehlt bezeichnen muss. Unter den zur Kritik herausfordernden Entwicklungen seien zwei herausgestellt, welche die Diskussion besonders geprägt haben. Das war zum einen der insbesondere bei empirischen Untersuchungen vorzugweise zur Anwendung kommende sogenannte Positionsansatz, wonach der Elitestatus all jenen zugeschrieben wird, die innerhalb der modernen bürokratischen Mammutgebilde, vor allem innerhalb des politischen Machtapparats, die Schlüsselpositionen besetzen oder, wie es Dahrendorf einmal ausgedrückt hat, »welche die Gesetze machen«. Daraus folgte, unmittelbar daran anschließend, zum anderen ein fast ausschließliches Interesse der Forschung für die als ungerecht empfundenen Mechanismen und Methoden der Elitenselektion. Diese anfechtbare Orientierung wissenschaftlicher Aufmerksamkeit soll kurz umrissen werden, bevor ein Alternativvorschlag zur Fassung des Elitebegriffs und der Form der Elitenauswahl präsentiert wird.
Die Ausdifferenzierung westlicher Gesellschaften in verschiedene Funktionsbereiche hatte eine inflationäre Vermehrung von Bezeichnungen für ihre Führungskader zur Folge. Man traf nicht nur eine Unterscheidung zwischen wirtschaftlicher, politischer, militärischer und klerikaler Elite, sondern reicherte das Begriffsspektrum um Ausdrücke wie Prestigeelite, Leistungselite, Selbst- und Fremdeinschätzungselite an. So viel Komplexität riskierte in ihr Gegenteil einer übertriebenen Vereinfachung umzuschlagen. Was sich langfristig durchsetzte, war der erwähnte Positionsansatz, das heißt, ausschlaggebend für das einem Individuum zuerkannte Attribut »elitär« sollte seine im Rahmen einer Großbürokratie erreichte herausgehobene Machtposition sein.
Mit der Einengung auf den Machtaspekt erreichte die für das Elitethema seit jeher bezeichnende Tendenz seiner positivistischen Verkürzung ihren Höhepunkt. Man kann sie als eine bedauerliche Fehlentwicklung bezeichnen. Ohne die Einbeziehung einer ethisch-normativen Komponente büßt das Elitekonzept jegliche beflügelnde Breitenwirkung ein und wird zur ein leeres Versprechen enthaltenden Worthülse, deren es schon viele gibt. Hier mag auch der tiefere Grund für das Missverständnis zwischen allgemeinem Eliteverständnis und deren Einschätzung durch die Wissenschaftler liegen: eine prinzipiell eher positive, ihnen Kompetenz und Initiativebereitschaft unterstellende Sichtweise auf der einen Seite und kritisch ihre Selbstbezogenheit und fehlende Gemeinwohlorientierung herausstellende Perspektive auf der anderen. Im Übrigen ist festzuhalten, dass sich westliche Gesellschaften mit ihrer an einem äußerlichen Merkmal, dem Erfolg im Machtkampf, festgemachten Elitendefinition einen Luxus leisten, für den es schwerfällt, eine geschichtliche Parallele zu finden. Ob man die Autoren der Antike heranzieht, sich für die Ritterlichkeitsideale des Mittelalters interessiert oder den Blick auf die vom Konfuzianismus geprägte Welt des Fernen Ostens richtet, stets waren sich die maßgeblichen Geister einig, dass Führungsfunktionen an moralische Vortrefflichkeit, Tugenden wie Selbstdisziplin, Gerechtigkeitssinn, Dienstleistungsbereitschaft für »das Ganze« und Verantwortungsbewusstsein gebunden sein sollten.
Mit der Gleichsetzung von Elitestatus mit privilegiertem Zugriff auf Macht- und sonstige Ressourcen ist zugleich das Hauptproblem angesprochen, um das seit Jahrzehnten die sozialwissenschaftliche Elitendiskussion kreist. Maßgeblich von politisch links stehenden Forschern beeinflusst, lässt sie die Frage der erforderlichen Qualifikation für Führungspositionen und wie man den Anwärtern darauf das notwendige Rüstzeug zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung vermitteln könnte, weitgehend links liegen. Ihr Engagement entzündet sich fast ausschließlich an der strukturellen Ungerechtigkeit, dass nicht allen Bürgern westlicher Nationen die gleichen Chancen offen stünden, in die entscheidenden Machtpositionen aufzusteigen. Schuld daran, so lautete die wiederkehrende Schlussfolgerung, seien die ungleichen Vermögensverhältnisse in unseren Gesellschaften. Diese verschafften den wirtschaftlich besser gestellten Familien einen uneinholbaren Vorsprung im allgemeinen Konkurrenzkampf, dem Nachwuchs die bestmöglichen Chancen für eine künftige »Elitekarriere« zuzuschanzen.
Es wird nicht näher auf diesen Forschungszweig eingegangen, weil er von demselben fragwürdigen Verständnis des Elitekonzepts als machtzentriert ausgeht wie der Positionsansatz. Will man die Ausklammerung einer ethischen Komponente aus dem Konzept verhindern, so reicht es nicht, ihm einen entsprechenden Zusatz, etwa indem man »Wertelite« als eigene Kategorie einführt, wie dies in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschehen ist, hinzuzufügen. Vielmehr sollte der Wertebezug im Elitebegriff selbst verankert werden, nicht als ausschließliches, aber als ein unentbehrliches Merkmal desselben.
Mein Vorschlag geht dahin, die elitäre Qualität eines Individuums nicht zuletzt an seinem Charakter festzumachen. Jemandem zu bescheinigen, er besitze Charakter, kann die Zuschreibung so unterschiedlicher Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Treue, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeitssinn, Weitblick und Urteilsfähigkeit, Verantwortungsgefühl, Zivilcourage und vieles mehr bedeuten. Entscheidend ist, dass sich die Vielzahl der einem Individuum zugeschriebenen Qualitäten zum Gesamtbild einer sich als integer darstellenden Gesamtpersönlichkeit verdichten. Etwas vereinfacht ausgedrückt, kann man eine Charakteranwartschaft all jenen bescheinigen, die mehr geben als sie nehmen, höhere Anforderungen an sich selbst als an ihre soziale Umwelt stellen. Ungeachtet der zahlreichen möglichen Eigenschaftskombinationen haben die meisten Menschen eine ziemlich klare Vorstellung davon, wem sie bereit sind, »Charakter« zu bescheinigen, wem nicht.
Legte man den Charaktermaßstab an die gängigen Machteliten an, so fiele das Ergebnis vermutlich enttäuschend aus. Weder im Rahmen ihrer Ausbildung noch für ihre Karriere in der Politik oder einem Großunternehmen fallen ethische Momente besonders ins Gewicht. Es ist unwahrscheinlich, dass diese sich ihnen, einmal in eine Schlüsselposition eingerückt, als besonders berücksichtigenswert aufgedrängt hätten.
Der Charakteransatz durchkreuzt die gegenwärtig dominante Forschungspraxis neben der Relativierung der Machtdimension noch in mehrfacher Hinsicht. Die Charakterformung eines Menschen ist nicht auf eine bestimmte Lebensphase, etwa seine Jugend, begrenzt. Sie setzt schon in der Kindheit ein und erstreckt sich über das ganze Leben, reicht in ihrer Prägewirkung manchmal sogar darüber hinaus. In traditionsbewussten Familien wird dem Nachwuchs beizeiten beigebracht, dass er nur ein Glied in einer etliche Generationen überspannenden Kette ist. Das bedeutet zugleich, dass die Phase der Sekundärsozialisation, in welche der derzeit als entscheidend betrachtete Schul- und Hochschulabschluss fällt, nur eine Teilphase des gesamten Sozialisationsprozesses darstellt. Das spricht dafür, ihre weichenstellende Funktion im Werdegang eines jungen Menschen nicht zu überschätzen, sondern daneben vorangegangenen und späteren Lern- und Bildungsphasen ebenfalls Beachtung bei der Beurteilung der Elitenreife einer Person zu zollen.
Würde sich, bleibt man beim Positionsansatz, an den besseren Chancen betuchter Oberschichtsprösslinge, sich als Eliteanwärter zu profilieren, kaum etwas ändern, so würde durch den Charakteransatz das soziale Rekrutierungsfeld und der Rekrutierungsprozess grundlegend umstrukturiert. Er würde zu einer erheblichen Erweiterung des Spektrums eliterelevanter Eigenschaften führen. Selbst wenn man am Kriterium fachlicher Exzellenz festhielte, wäre die Elite nicht mehr nur auf einige tausend Mitglieder einer Gesellschaft begrenzt. Kandidaten für den Elitestatus ließen sich auf allen sozialen Ebenen, nicht nur in ihren höchsten Rängen ausmachen, immer vorausgesetzt, dass zwei Grundbedingungen erfüllt sind: dass es sich um Persönlichkeiten handelt, die sich durch besondere, nicht zuletzt charakterliche Fähigkeiten auszeichnen, deren Vortrefflichkeit breite Anerkennung findet.
Damit ließe sich zugleich ein Manko heilen, das der Elitetheorie von Anfang an anhaftete: Ihre einseitige Konzentration auf die Minderheit der Auserlesenen, während sie über die restliche Bevölkerung, die »breite Masse«, nichts aussage. Lässt man es bei der reinen Machüberlegenheit als Elitemerkmal bewenden, so bliebe es bei der schlichten Unterlegenheit und Abhängigkeit der Mehrheit von den Entscheidungsträgern als ihr bezeichnendes Charakteristikum. Verlangte man der Elite dagegen auch charakterliche Qualitäten ab, so würde die Kluft zwischen beiden Seiten teilweise überbrückt. Denn die Anerkennung charakterlicher Vorzüge ist in stärkerem Maße eine Frage sozialer Billigung als die Unterwerfung unter überlegene Machtressourcen. Die Zuerkennung persönlicher Integrität »von unten« ist nur möglich, wenn die den Ruf der Vortrefflichkeit begründenden Eigenschaften auch an der sozialen Basis geschätzt werden.
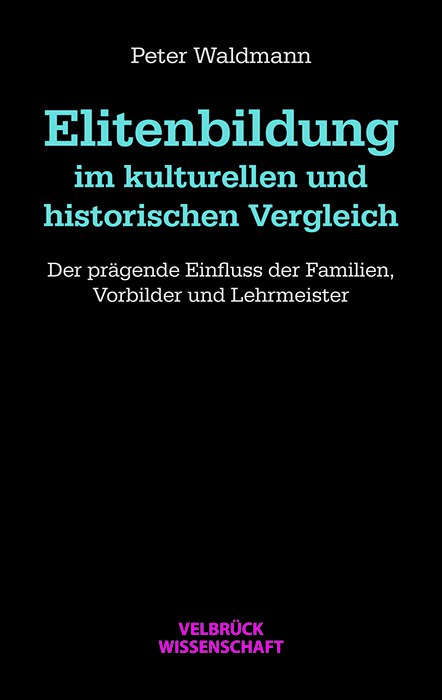
Elitenbildung im kulturellen und historischen Vergleich
Der prägende Einfluss der Familien, Vorbilder und Lehrmeister
- 208 Seiten, broschiert
- ISBN 978-3-95832-378-0
- 39,90 €
