Auch die Musik läuft in der Zeit ab. Das ist banal. Aber die Frage, wie dies geschieht, wie also die Musik mit der Zeit umgeht, wie sie sie gestaltet, ist weitaus weniger trivial. Ferdinand Zehentreiter geht ihr in seinem Beitrag für das Velbrück Magazin nach. Der Aufsatz stellt eine Skizze dar von Überlegungen, die in seinem Buch »Musikalische Zeit. Eine relativitätstheoretische Perspektive« (Velbrück Wissenschaft, 2025) eingehender entfaltet werden.
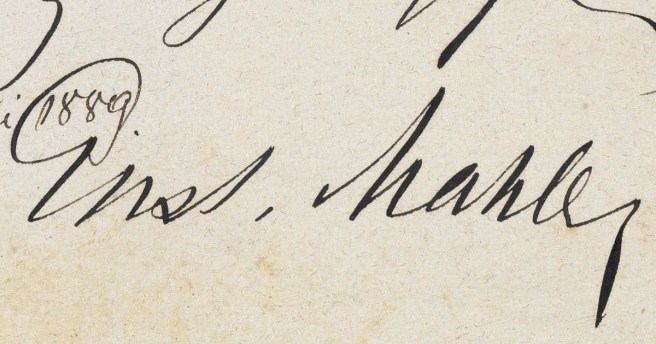
Ferdinand Zehentreiter
Musikalische Zeit
Eine Skizze[1]
»Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.«
(J.S. Bach, Actus tragicus)
Vorbemerkung
Um das Thema »Musikalische Zeit« nicht, wie das gerne geschieht, von vorneherein zu mystifizieren als eine überaus heikle, nur mit äußerster geisteswissenschaftlicher Vorsicht zu behandelnde, Angelegenheit, empfiehlt es sich, zunächst zu klären, worum es in der begrifflichen Kombination von »Musik« und »Zeit« überhaupt gehen kann. Es wäre trivial, unter der Zeitlichkeit von Musik lediglich ihre allgemeine Bestimmtheit durch die Zeit, der alle Phänomene unserer Wirklichkeit, die Natur wie die Sozialwelt, unterliegen, zu verstehen. Es ist kein großes Geheimnis, dass natürlich auch die Musik in der Zeit abläuft. Vielmehr wollen wir etwas über die Art und Weise wissen, wie dies geschieht, wie also die Musik mit der Zeit umgeht, wie sie sie gestaltet. Unser Thema lautet daher genauer: Musik als gestaltete Zeit, noch genauer: Musik als autonom gestaltete Zeit, und hier richtet sich der Blick, wie stets, wenn es um die strukturellen Eigenarten von Musik geht, auf die Kunstmusik, deren Aufgabe ja darin besteht, die Möglichkeiten dieses Ausdrucksmediums exemplarisch auszuloten. Es wird sich dabei zeigen, dass die Geschichte des Komponierens auch als Autonomisierung einer genuin musikalischen Zeit verstanden werden kann. Daher stellt es auch keinen Zufall dar, dass gerade in der »Neuen Musik« der beiden ersten Dezennien nach dem Zweiten Weltkrieg (der Begriff scheint im Wesentlichen – auch als kritischer Maßstab – nur für diesen Zeitraum sinnvoll zu sein), die sich gehalten sah, über die Grenzen ihres Ausdrucksmediums hinauszugelangen, das Thema Zeit eine so zentrale Rolle spielte.
Zur allgemeinen Bestimmung der Zeit
Doch bevor wir uns der Zeit der Musik zuwenden, ist es geboten, ein paar Bestimmungen zu der Zeit im Allgemeinen zu versuchen. Wenn diese, anders als der Raum, immer wieder zu tiefsinnigen Ausführungen über ihre Ungreifbarkeit bzw. die Illusion ihrer Greifbarkeit Anlass gegeben hat, so liegt dies natürlich auch an der Komplexität der dafür zuständigen Theorien, mögen sie aus der Physik oder aus den Sozialwissenschaften stammen. Vor allem dem Pragmatismus Georg Herbert Meads (Mead, 1969) und dem genetischen Strukturalismus Jean Piagets (Piaget, 1974) sind hier auch Beiträge zu einer genuin sinntheoretischen Form der Relativitätstheorie zu verdanken. Dazu kommen natürlich noch Stimmen aus der Philosophie, die ebenfalls im 20 Jahrhundert neuartige und bisweilen kühn konstruierte Beiträge geliefert haben, nicht zuletzt Alfred Whitehead, Edmund Husserl und Martin Heidegger.
Aber es geht uns in diesem Rahmen nicht um den direkten Einbezug solcher Paradigmen, da er ihn erbarmungslos sprengen würde, sondern vielmehr um den direkten Zugriff auf elementare Eigenschaften des Phänomens, von der jede Zeittheorie ausgehen muss.
(1) Zunächst einmal ist die untrennbare Einheit der beiden basalen Zeitdimension offene Bewegung und übergreifende Strukturbildung festzuhalten. Man spricht ebenso selbstverständlich von zeitlichem Fluss wie von zeitlichen Verhältnissen. Letztere zeigen sich an der hierarchischen Verklammerung von Zeitintervallen, die die objektive Grundlage der Zeitmessung darstellen. Es ist bereits an dieser Stelle die Ermahnung fällig, keinen Dualismus zwischen diesen beiden Dimensionen zu konstruieren, da man durch diesen, wie manche prominente philosophischen Zeittheorien, etwa die von Bergson, nur zwei unverbundene Hälften des Phänomens in Händen behält. Vielmehr zeigt sich bereits an diesem Verhältnis ein erstes Mal die basale Dialektik von zeitlicher Kontinuität und Diskontinuität. Auch führt nur eine dialektische Bestimmung des Verhältnisses von Zeitfluss und zeitlicher Gliederung zur musikalischen Zeit, die sich wesentlich in einer Maximierung des unauflöslichen Spannungsverhältnisses zwischen diesen beiden ausgebildet hat.
(2) Die Seite der zeitlichen Gliederung verweist auf eine weitere basale Qualität von Zeit. Man kann daran sehen, dass sie, wie der Raum, trotz ihrer Bedeutung als basaler Dimension der Wirklichkeit, ihrerseits eine höher organisierte Form der Wirklichkeit voraussetzt, also mindestens eine Welt aus gegeneinander bewegten Massen und Feldern mit ihren Proportionen, Abständen und Abfolgen. Ein unorganisiertes Universum aus zufälligen Ereignissen würde weder Raum noch Zeit besitzen, aus diesem Grund kann es auch keinen völlig indeterministischen Begriff von Zeit geben. Man darf sich an dieser Stelle die kosmologische Spekulation gönnen, dass Raum und Zeit nicht von Anfang an bestanden haben, sondern ein Entwicklungsprodukt des Universums darstellen. Die Neue Musik hat, etwa in den ersten serialistischen Kompositionen, Beispiele für die Paradoxie geliefert, kompositorisch auch noch in diesen Vorbereich hinein zu gelangen.
(3) Wenn Zeit und Raum bereits eine strukturierbare bzw. sich strukturierende Materie voraussetzen, so stellen die Ausdehnung und die Bewegung als Abfolge von Veränderungen die elementarsten Dimensionen der Wirklichkeit dar, in denen Raum und Zeit sich konstituieren. Daran lassen sich zwei weitere Überlegungen anschließen. Zunächst: Was die Zeit angeht, ist es sinnlos, sie als eine von den konkreten Bewegungen abgehobene eigenständige Wirklichkeit zu betrachten, die natürlich als solche nirgends greifbar ist. Sie gehört immer schon den materiellen Verhältnissen zu, stellt sie doch nichts anderes dar als die sich strukturierende Bewegung der Materie selbst.
Dann: In dieser Konkretheit berührt sich die Zeit unmittelbar mit dem Raum, beide sind sie in derselben Wirklichkeit verankert, die sie nur je anders organisieren. Da die Materie sich stets in Bewegung befindet, besitzt auch ihre Ausgedehntheit eine dynamische Qualität. Alle Massen und Felder bewegen sich in bestimmten Abständen und einem unaufhörlichen Nacheinander materieller Vorgänge gegeneinander. Man tut also gut daran, elementar von Ausdehnung und nicht bloß von Ausgedehntheit zu sprechen. So sind Ausdehnung und Bewegung untrennbar miteinander verbunden, besitzt die Ausdehnung stets dynamischen Charakter und sind materielle Abläufe stets verortet in materiellen Verhältnissen. Wenn Raum und Zeit nur verschiedene Ordnungsweisen derselben Wirklichkeit bilden, gibt es keinen Raum ohne Zeit und keine Zeit ohne konkreten Raum. Wir haben es mit einer Raum-Zeit zu tun. Dies verweist auch auf die musikalische Zeit. Auch diese existiert nur in materiellen, hier klanglichen Gestaltverhältnissen, und so lässt sich auch von einer musikalischen Raum-Zeit sprechen, die auf klanglichen Gestaltformierungen beruht.
Dabei haben wir noch eine Asymmetrie zwischen diesen beiden Dimensionen zu berücksichtigen. Sowohl zur Ausdehnung als auch zur offenen Abfolge materieller Ereignisse gehört ja die Qualität der Bewegung. Der Raum bezeichnet also als eine spezifische Form materieller Bewegungen nur ihre jeweilige Ausgedehntheit und ihre jeweils darin bestehenden Verhältnisse.
Nun lassen sich auch in dieser Dimension Bewegungen eintragen. Aber bei diesen handelt sich um bloße vertauschbare Umstellungen, in denen räumliche Abstände in verschiedenen Richtungen durchmessen werden können. Hier fehlen die entscheidenden Qualitäten der vollständigen Bewegung, wie sie die Zeit als spezifische Logik der Abfolge besitzt. Genauer ausgedrückt: Geht es im Raum nur um das umstellbare Miteinander der Dinge, so bezieht sich die Zeit auf ihr Nacheinander. Zu diesem gehört aber auch die Irreversibilität und die je individuelle Geschwindigkeit. Bezieht dieses Nacheinander sich immer auch auf Verhältnisse im Raum – es gibt etwa keine reine, immaterielle Geschwindigkeit –, so stellt die Zeit eine spezielle Perspektive auf die vollständige Raum-Zeit dar, während der Raum sich nur auf die Ausgedehntheit bezieht. Er lässt sich daher auch einfacher bestimmen, was sich etwa darin zeigt, dass eine zentrale Reduktion zeitlicher Bestimmungen darin besteht, sie in räumliche zu verwandeln – wie im Falle von akademischen Kategorien musikalischer Form.
(4) Jean Piaget, der auf Anregung von Albert Einstein eine zentrale Studie über die »Bildung des Zeitbegriffs beim Kinde« (Piaget, 1974) geschrieben hat, bezeichnet Raum und Zeit in diesem Sinne als zwei zusammengehörige Formen einer »Logik der Dinge«, somit als abstrakte Relationen innerhalb der für sie geeigneten konkreten materiellen Verhältnisse. Man kann dafür den Begriff der Welt 3 objektiver logischer Strukturen in Anspruch nehmen, wie ihn vor allem Frege, Popper und Mead (mit seinem Begriff »meaning« als objektiver Bedeutung von Sozialität) je eigen formuliert haben. Bei allen dreien wird die Logik nicht mehr originär als gedachter Zusammenhang im Kopf verstanden. Dieser steht hier vielmehr für die durch produktive Internalisierung von Beziehungen der Welt 3 sich bildende Welt 2 der subjektiven Reflexion. Der Idealismus erscheint in diesem Licht als Gleichsetzung von Welt 2 und Welt 3. Jenseits von diesem muss die Welt 3 als noch nicht vorgedachter bzw. nicht vorweg denkbarer, aber nachträglich rekonstruierbarer innerer Zusammenhang der objektiven Wirklichkeit, sei es die Natur oder die sinnhafte Welt, gedacht werden. Claude Lévi-Strauss hat dies exemplarisch in der Entgegensetzung zwischen Formalismus und Strukturalismus formuliert.
»Anders als der Formalismus weigert sich der Strukturalismus, das Konkrete dem Abstrakten gegenüberzustellen und dem letzteren einen privilegierten Wert zuzuerkennen. Die Form definiert sich im Gegensatz zu einer Materie, die ihr fremd ist; aber die Struktur hat keinen von ihr unterschiedenen Inhalt: sie ist der Inhalt selbst, erfaßt in einer logischen Organisation, die als eine Eigenschaft des Realen gilt« (Lévi-Strauss, 1975, S. 135)
(3) Das Zitat von Lévi-Strauss lässt sich auch fruchtbar auf das Zeitmodell von Piaget übertragen. Wenn die inneren Zusammenhänge der objektiven Welt als Komplement zu den Denkvorgängen des Subjekts, das sie internalisiert, verstanden werden können, so gilt dies auch für das Verhältnis von objektiver Zeit als einer Logik der Bewegung und der Zeit als einer gedachten Form. Man muss so nicht, wie oft geschehen, das subjektive Denken der Zeit von der objektiven Zeit als einer bloß messbaren Größe spalten. Weder stellt die unreduzierte Zeit, so wie bei Kant, eine »reine Anschauungsform« des Subjekts dar, noch lässt sie sich physikalistisch reduzieren auf die bloße mechanische Wiederholung einer Grunddauer, die in ihrer Uniformität noch nicht einmal die Differenz zwischen neu und alt kennt. Auch hier gilt: Alle Versuche, dieses Ineinander aufzuspalten, behalten nur unverbundene Hälften zurück. An der musikalischen Zeit lässt sich die Untrennbarkeit von objektiver Form und kompositorischem Denken exemplarisch erfassen.
(4) Die Abhebung der zeitlichen Ordnung von einer bloß chronometrischen Objektivität führt wieder zurück zu dem basalen Ineinander von offenem Zeitfluss und übergreifend gegliederten zeitlichen Verhältnissen. Wir sprachen bereits von der Dialektik von Kontinuität und Diskontinuität, die in diesem Ineinander liegt. Das bloße Kontinuum kennt keine trennenden Gliederungsmarkierungen, damit auch keine inneren Verhältnisse, gleichzeitig gehen auch diese in einer offenen Abfolgebewegung auseinander hervor. Zeit als Kontinuum von Vorgängen stellt immer auch eine Folge distinkter Zeitintervalle oder Zeitsegmente, die hierarchisch ineinander verschachtelt sind, dar. Der Raum wiederum lässt sich charakterisieren als hierarchisches Gefüge aus bestimmbaren Abständen zwischen voneinander entfernten Raumpunkten.
Musikalische Form als musikalische Raum-Zeit.
Dies gibt nun Anlass zu ersten genaueren musikästhetischen Schlussfolgerungen. Man kann sagen, dass zu musikalischen Prozessen immer auch ein in sich gegliederter übergreifender Zusammenhang von einander folgenden Abschnitten gehört, also eine dynamische Form. Genauer formuliert: Musikalische Zeit stellt eine Logik musikalischer Abläufe dar, in der der offene Klangfluss untrennbar verbunden ist mit einer hierarchisch gegliederten Folge von Zeitsegmenten. Die Ablaufdimension von Musik kann sich nur entfalten in der Konkretion von Klanggestalten mit ihren räumlichen Abständen. Musikalische Abläufe gerinnen stets in klanglichen Verhältnissen, damit auch in messbaren Proportionen. Man daher von der musikalischen Form als der Raum-Zeit der Musik sprechen. Diese stellt auch die Basis für musikalischen Sinn dar, sobald die strukturelle Artikulation klanglicher Verläufe einen Bedeutungsgehalt evoziert. Unter der Bedingung des musikalischen Sinnes gerinnen musikalische Verläufe nicht nur stets zu klanglich-materiellen Räumen, sondern auch zu Symbolräumen.
Dies steht im Widerspruch zu dem akademischen Begriff der musikalischen Form, der diese als Raum behandelt – und nicht als innere Logik eines stets individuellen materialen Geschehens. Nicht zufällig spricht man hier auch gerne von »Formschemata«. Form stellt sich hier dar als ein hierarchisch segmentiertes Gehäuse, also als Tektonik, wie die Aufgliederung eines Gebäudes. Der Begriff der musikalischen Abfolge deckt sich dabei mit dem hierarchischen Nebeneinander der Formteile: Das Hauptthema, die Überleitung zum Seitenthema, das Seitenthema selbst und ein Beschluss fügen sich miteinander zur Exposition. Auf dieser übergreifenden Aggregierungsebene bilden Exposition, Durchführung und Reprise eine symmetrische Anordnung, nach der gerne noch eine Coda folgt. Seit Beethoven wird diese gleichwertig behandelt als vierter Formteil. Natürlich gehorcht auch die Analyse der Durchführung trotz der dichteren Dramatik dieses Formteils einer solchen Schematisierung. Der so segmentierte Kopfsatz einer Sonate stellt nun seinerseits auf der Aggregierungsebene ihres Satzzyklus den ersten Satz von drei oder vier weiteren, ebenfalls segmentisierbaren Sätzen dar. Es ist klar, dass diese Klassifikationsweise historisch begrenzt ist, gerade mit Blick auf die Gattung der Sonate. Mit der musikalischen Romantik spaltete sich deren Entwicklung in Bemühungen um eine Fortführung dieser Bauweise, paradigmatisch bei Brahms, und ihre weitgehende Transformation, etwa in der einsätzigen Verschränkung aller vier Sätze, paradigmatisch in der h-moll-Klaviersonate von Franz Liszt. Aber auch ihre mehrsätzige Gestalt, wurde, etwa bei Gustav Mahler, vielgesichtig bzw. vieldeutig. Das heißt nun aber nicht, dass die akademische Behandlung der Sonatenform damit gesprengt worden wäre, im Gegenteil. Je weniger sich ihre Kategorien anwendbar zeigten, umso leerer oder mehrdeutiger wurden sie.
Zu den wichtigsten und gleichzeitig schärfsten Kritikern dieser Reduktion von musikalischer Form-Zeit auf den äußeren Raum einer hierarchischen Tektonik gehört Theodor W. Adorno. In seinem späten Vortrag »Form in der neuen Musik« klingt dies so:
»Der Begriff der Form, bezieht sich, als ästhetischer, auf alles Sinnliche, wodurch sich der Gehalt eines Kunstwerks, das Geistige des Gedichteten, Gemalten, Komponierten, verwirklicht. […] Demgegenüber ist die Bedeutung des Wortes Form in der Musik herkömmlicherweise […] enger. Sie erstreckt sich auf die in der Zeit sich realisierenden musikalischen Verhältnisse. Vorab wird dabei an die Artikulation ausgedehnterer Zusammenhänge gedacht. […] Der schulmäßige Gebrauch des Wortes Formenlehre, der zunächst Typen wie Lied, Variation, Sonate, Rondo, allenfalls auch Fuge, gilt, genügt, die engere Bedeutung von Form zu demonstrieren. […] Was man in der Musik […] unter Form verstand, [waren] mehr oder minder verbindliche Schemata, innerhalb derer die Komponisten sich ergingen, […].« (Adorno, 2003, S. 207)
Wenn die »in der Zeit sich erstreckenden Verhältnisse« als »Schemata« behandelt werden, haben wir es eben nicht mit einer vollständigen Bewegung zu tun, sondern um eine Folge von Abstandseinteilungen im Raum, die nur als Nebeneinander ihre Geltung hat. Diese steht abgehoben von der Irreversibilität des darunter subsumierten, daher austauschbaren, realen musikalischen Geschehens. Adorno selbst hat dieser Verdinglichung von Musik in seinem Versuch einer Reform des musikalischen Formbegriffs eine dynamische Kategorie entgegengesetzt, die der »Schrift«. Seine Monographie über Gustav Mahler stellt den Versuch der Formulierung einer neuartigen, unschematischen Methode der musikalischen Analyse dar, die er »materiale Formenlehre« oder auch »musikalische Physiognomik« nennt. Sie stellt die Kehrseite eines entschematisierten und so verzeitlichten Begriffs der musikalischen Form dar, die von Adorno als je individueller Ausdrucks-Prozess verstanden wird. Es muss dabei festgehalten werden, dass zur musikalischen Form auch in dieser Perspektive noch eine schematisierbare Tektonik gehört bzw. zu gehören hat. Kein geistiges Gebilde kommt aus ohne die strukturelle Mindestqualität eines in sich gegliederten Ganzen, es darf sich nur nicht darauf beschränken. Dies ist wichtig festzuhalten, da die Diskussion um die freie musikalische Form bisweilen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat und mit der schematisierten Tektonik die Tektonik als solche abschaffen wollte – auch im Sinne eines missverstandenen Adorno. Ohne das strukturelle Moment einer hierarchischen Verklammerung distinkter Gruppen käme nur eine gestalt- und entwicklungslose Reihung von Elementen zustande, die keinen inneren Bezug zueinander besitzen. Es muss daher um eine andere Unterscheidung gehen, also die zwischen einer vorgegebenen Tektonik und einer, die sich im Zuge eines individuellen Prozesses mit diesem ins Offene hinein aufbaut bzw. aufschichtet. Man kann so von einer generativen Tektonik sprechen.Die akademische Formenlehre geht von dem übergeordneten Baukasten aus statt von dem je individuellen musikalischen Prozess, aus dem die Tektonik in der offenen Abfolge der Formteile entsteht. Die Werke kommen so nur als vorgegebene Schemata mit austauschbarem Füllwerk in den Blick.
Adorno möchte hingegen mit seinem Begriff der Form als Schriftzug ihren dynamischen Charakter und damit ihre Individualität, die sich in einer unverwechselbaren dramatischen Linie zeigt, geltend machen.
»Mahler ist in Perspektive nur dadurch zu rücken, daß man noch näher an ihn heran, daß man in ihn hineingeht und dem Inkommensurabeln sich stellt (…) Seine Symphonik hilft dazu durch die zwingende Spiritualität ihrer sinnlich-musikalischen Konfigurationen. (…) Indem ein jeglicher ihrer Augenblicke, ohne Ausweichen ins Ungefähre zu dulden, seiner kompositorischen Funktion genügt, wird er (…) eine Schrift, welche die eigene Deutung vorschreibt. Die Kurven solcher Nötigung sind betrachtend nachzuzeichnen« (Adorno, 1986, S. 152)
Mit seinem Begriff der »materialen Formenlehre« kommt Adorno, da er die Form ja als individuellen Prozess, also als geformte Zeit, versteht, recht nahe an die Bestimmung von musikalischer Form als musikalischer Raum-Zeit heran. Die Musikalische Zeit wird hier als innere Qualität eines musikalischen Geschehens mit seiner materialen Dynamik geltend gemacht. Die musikalischen Zeitstrukturen bilden sich in der materialen Bewegung eines Werkprozesses. Beklagenswerterweise hat Adorno sein neues Analyse-Modell nicht so zugespitzt ausgearbeitet, dass damit hinreichend die Differenz zwischen einer neuen Methode der musikalischen Strukturanalyse und einem nur beschreibenden Nachvollzug des musikalischen Geschehens, seiner bloßen Nacherzählung, gemacht werden könnte. Damit verfehlt er am Ende doch auch eine zentrale Qualität der musikalischen Zeit.
Die Zeit als vollständige Bewegung
Um diese genau fassen zu können, bedarf es einer nochmaligen Rückwendung zum Begriff der Zeit im Allgemeinen. Wir hatten bislang folgende Grundqualitäten von ihr angeführt: Sie besteht aus einer unlösbaren Einheit von Zeitfluss und zeitlicher Ordnung; zu letzterer wiederum gehört die Verschränkung von Reihenfolge und übergreifender Gliederung von Zeitintervallen; Zeit entfaltet sich stets als innerer Zusammenhang materieller Bewegungen bzw. eines materiellen Gestaltaufbaus, also nicht abgehoben wie eine ungreifbare, mysteriöse Sphäre; Zeit beruht so auf einer untrennbaren Einheit von Abfolge-Bewegung und sich gliedernder materieller Ausdehnung. Zeit und Raum stellen spezifische Organisationsformen dieser Einheit dar: die Zeit als Struktur der Abfolge materieller Bewegungen, der Raum als die Struktur der jeweiligen Ausgedehntheit materieller Bewegungen. In diesem Miteinander bilden sie die Raum-Zeit. Dabei lässt sich, wie wir gehört haben, die Zeit als Logik der Abfolgen in der vollständigen Raum-Zeit verstehen, der Raum aber nur als Logik von Umstellungen in jeweiligen Verhältnissen der Ausgedehntheit.
Nun müssen wir noch den beiden bereits genannten Qualitäten von Zeit nachgehen, durch die sie sich als vollständige Bewegung von den einfachen Umstellungen im Raum unterscheidet: die Geschwindigkeit (mit ihren Veränderungen durch Beschleunigung und Verlangsamung) und die Unumkehrbarkeit. Wir werden sehen, dass mit diesem Komplex auch die Möglichkeit der Metrisierung von Zeit verbunden ist, also die der quantitativen Zeitmessung.
Es empfiehlt sich, den Einstieg mit der Eigenschaft der Geschwindigkeit (5) zu machen, da sie die Voraussetzung für die Bestimmung der beiden anderen Eigenschafen liefert und überdies jenen entscheidenden Blick auf die Zeit erlaubt, der seit der Relativitätstheorie möglich ist (im Übrigen konnte auch Piaget die je individuelle Geschwindigkeit als elementarste Eigenschaft von genuin zeitlichen Bewegungen Bewegung bestimmen). Man kann hier mit Blick auf unser Thema fast von einer Umkehrung der beiden zentralen Kategorien sprechen, also von einem musikalischen Charakter der Zeit. Die Zeit ist nicht identisch mit einem einzigen durchgehenden Verlauf, in dem alle jemals auftretenden Einzelverläufe miteinander enthalten wären, als aufeinanderfolgende, gleichzeitige sowie einander überlappende Abschnitte davon bzw. als Segmente eines übergreifenden Zusammenhangs. Vielmehr muss sie als eine Polyphonie divergenter, sich gegeneinander bewegender Abläufe mit ihrer je eigenen Geschwindigkeit, damit auch ihrer eigenen Messperspektive gedacht werden, die mit dem Konzept einer abgehoben einheitlichen Zeitmessung bzw. einer absoluten Uhr (wie noch bei Newton) unvereinbar ist. Man muss für diese Einsicht nicht gleich zu Einstein greifen, auch wenn sie bei ihm einen Paradigmenwechsel des physikalischen Denkens bedeutete. Aber im Kern findet sie sich bereits bei Herder.
»Eigentlich hat jedes veränderliche Ding das Maß seiner Zeit in sich; […] keine zwei Dinge der Welt haben dasselbe Maß der Zeit. Mein Pulsschlag, der Schritt oder Flug meiner Gedanken ist kein Zeitmaß für andre; der Lauf eines Stromes, das Wachstum Eines Baums ist kein Zeitmesser für alle Ströme, Bäume und Pflanzen. […] und wie verschieden ist das Zeitenmaß in allen Planeten! Es gibt also (man kann es eigentlich und kühn sagen) im Universum zu Einer Zeit unzählbar-viele Zeiten […].« (Herder, 1998, S. 360)
Mit Einstein wurde klar, dass es keine absolute Gleichzeitigkeit, damit keine absolut gleiche Bestimmung des Zeitintervalls zwischen zwei Ereignissen (im Extremfall eben keine Zeitdifferenz) gibt. Die in dem System, in dem die zu messenden Ereignisse vorgenommen werden, ruhenden Uhren zeigen für die Zeitdifferenz zwischen diesen Ereignissen einen höheren Wert an als Uhren aus anderen Systemen, die sich diesem gegenüber in Bewegung befinden und so also im Vergleich langsamer gehen (Zeitdilatation). Man spricht von Relativität, da es keine absolute Differenz zwischen ruhenden und bewegten Uhren gibt, sondern nur eine relative: Die Uhren in unterschiedlichen Systemen erfassen sich selbst als ruhende mit ihrer »Eigenzeit« und die je anderen als bewegte. Das heißt im Übrigen auch, dass die Messapparate als Beobachter zu der von ihnen beobachteten Wirklichkeit gehören, also von ihr determiniert werden. Es gibt hier keine vom Beobachter abgetrennte objektive Wirklichkeit, wie sie die Philosophie der Physik gerne vorrechnet. Überdies steht jede Messung in einem unabschließbaren Vergleich von Messungen, sie stellt keine einfache Abbildung der Wirklichkeit dar.
Uns interessieren hier aber nicht diese relativitätstheoretischen Überlegungen als solche, also auch nicht die Rolle der Lichtgeschwindigkeit, die hier den invarianten Maßstab der höchstmöglichen Geschwindigkeit bildet, ohne den die Relativität nicht bestimmt werden könnte, sondern ihr Bezug auf die noch zu klärenden beiden anderen unterscheidenden Eigenschaften von Zeit – mit ihrer musikalischen Relevanz.
Die gemessene Zeit als Dimension der zeitlichen Offenheit
Zur zukunftsoffenen Nichtumkehrbarkeit zeitlicher Bewegungen tritt hier zunächst die Möglichkeit, ja Notwendigkeit, ihrer Metrisierung, ihres quantifizierenden Vergleichs. Jean Piaget hat in seiner Untersuchung des Zeitbegriffs beim Kinde die wohl schlagendste Begründung dafür vorgelegt, dass die Zeitmessung keine leere Formalisierung der konkreten Zeiterfahrung darstellt, sondern unvermeidlicher Ausdruck ihrer Grundlagen ist. Ohne Fähigkeit und Möglichkeit der Zeitmessung, und sei sie nur geschätzt, gibt es kein entwickeltes bzw. unverzerrtes Bewusstsein zeitlicher Verhältnisse – was natürlich auch und gerade für die Würdigung der musikalischen Zeit von einschneidender Bedeutung ist. Wir wollen uns auch hier nur mit dem Ergebnis dieser Untersuchung begnügen, die an Komplexität kaum zu überbieten ist. Piaget orientiert sich darin von Grund auf an Einsteins Erkenntnis des polyphonen Charakters von Zeit. Die Entwicklung des subjektiven Zeitbewusstseins besteht in nichts anderem als in der Ausbildung der stabilen inneren Vorstellung dieser Polyphonie – welche erst ab der Pubertät beherrscht werden kann. Erst dann ist ein Subjekt in der Lage, zeitliche Ordnungsbestimmungen stabil durchzuführen, und das sind eben solche, die Messungen entsprechen, auch noch ohne direkte numerische Präzisierung. Es geht also um so elementare Urteile wie »länger oder kürzer dauernd als«, »gleichzeitig« oder »nicht gleichzeitig« verlaufend/beginnend/endend, die Einschätzung von Überschneidungen usw., die, wie Piaget zeigen konnte, von Kindern nicht ohne gravierende Verzerrungen durchgeführt werden können. Da die objektive Zeit aus verschiedenen Ablaufordnungen mit dem jeweiligen Verhältnis ihrer Abschnitte zueinander besteht, hat es das Zeitbewusstsein elementar mit dem komplexen Problem zu tun, mindestens zwei verschiedene Ablaufordnungen gleichzeitig zu erfassen und dabei in ihrem inneren Zusammenhang zu koordinieren. Genauer gesagt: Es muss einerseits von allen begegnenden Zeitabläufen die interne Intervallreihenfolge mit ihrer hierarchischen Gliederung erfassen und gleichzeitig das übergreifende Verhältnis der unterschiedlichen inneren Ordnungen, die die verschiedenen Abläufe besitzen, zueinander. Dabei sind zwei Punkte wesentlich: (a) Die korrekte Binnenerfassung eines bestimmten Ablaufs entwickelt sich gleichzeitig mit der korrekten Bezugnahme unterschiedlicher Abläufe aufeinander, sie kann ihr nicht vorausgehen. (b) Diese unhintergehbare Gesamterfassung besitzt den Charakter eines messenden Blickes – der verschiedene zeitliche Abfolge-Relationen quantitativ aufeinander beziehen kann. Wer zeitliche Gliederungen und Verhältnisse genauer erfassen oder gestalten möchte, kann dies nur in intuitiven quantitativen Einschätzungen machen, die immer schon Vorstufen einer numerischen Bestimmung sind.
Hierin liegt eine, häufig verkannte, zentrale Perspektive auf die musikalische Zeit. Weder die Qualität des Flusses von Musik noch die intuitive Vorgehensweise des Komponisten sollte zu dem Missverständnis verleiten, die Dimension der numerischen Messung sei der Musik fremd – alles andere als das. Und dabei ist nicht gleich an spezielle artifizielle Konstruktionen zu denken, wie sie etwa beim späten Bach vorliegen oder gar in der Neuen Musik zum Extrem getrieben wurden. Die Geschichte des Komponierens zeigt uns vielmehr das Gegenteil. Dessen Autonomisierung war unhintergehbar gebunden an die Etablierung quantitativ messbarer Elemente und Dimensionen: feste notierbare Werte, seien es Tonhöhen oder rhythmische Einheiten, metrische Schemata, festgelegte Tempi und eine übergreifende Taktgliederung, an der wiederum genauestens ausgezirkelte architektonische Gruppierungen abgelesen werden können, zu der wiederum initial periodische Bildungen gehörten. Wir wissen, dass dies nichts mit der formalistischen Zerstörung eines vormals frei flutenden musikalischen Geistes zu tun hatte, sondern im Gegenteil erstmals konstitutive Sprachmittel für die Erzeugung individueller prozessualer Gestaltbeziehungen lieferte, die auch den unhintergehbaren Ausgangspunkt für Differenzierungen der musikalischen Form jenseits jeder Schematisierung darstellen sollten. Aber auch diese, und dies ist entscheidend, gehorchten noch der übergreifend kontrollierten Bezugnahme zwischen kompositorisch möglichst genau festgelegten Zeitintervallen. Man sollte sich eben an den Gedanken gewöhnen, dass eine solche »Kontrolle« gestaltintuitiv möglich und gefordert ist.
Messung und spontane Kreativität stehen also in der Musik nicht im Widerspruch zueinander, solange die numerischen Einteilungen von der kompositorischen Phantasie geführt werden. Auch Piaget geht auf diese innere Metrik der Musik ein, wenn er die irrationale Sicht Bergsons kritisiert.
„Die schönsten Bilder, an denen das Werk Bergsons so reich ist, sind der Musik entliehen, und wenn dieser Meister der Introspektion das Anschauliche und Antirationelle, Auf-nichts-anderes-Zurückführbare der schöpferischen Dauer ausdrücken will, so greift er zu Worten der Melodie, des Rhythmus und der Symphonie. Aber die Musik ist ja gerade die innere Mathematik, und lange schon bevor Pythagoras die einfachen Verhältnisse in den harmonischen Akkorden entdeckt hatte, bildete der antike Hirte bei seinen Gesängen oder bei seinem Flötenspiel Tonleitern, und wußte, ohne sie benennen zu können, daß eine halbe Note zwei Viertelnoten und eine Viertelnote zwei Achtelnoten hat. Der musikalische Rhythmus ist sogar von allen zeitlichen Metriken die am direktesten anschauliche und wird uns gewiß nicht von der Außenwelt aufgedrungen.“ (Piaget, 1974, S. 393)
Man muss aber nicht gleich zu Bergson greifen, um auf Vorurteile gegenüber der numerischen Ordnung in der Musik zu stoßen. Es besteht offenkundig ein tiefsitzendes Bedürfnis, den musikalischen Fluss in einen unversöhnlichen Gegensatz zur musikalischen Ordnung zu bringen, ohne dabei das ästhetische Desaster zu sehen, das damit angerichtet wird. Ein signifikantes, da bekenntnishaftes, Beispiel dafür stellt Dieter Schnebels Aufsatz »Auf der Suche nach der befreiten Zeit. Erster Versuch über Schubert« (Schnebel, 1979). Schnebel macht diese Befreiung an dem neuartigen harmonischen Fluss bei Schubert fest, so dass man in seinem Sinne genauso gut von dem befreiten Klang bei Schubert sprechen könnte. Kurz gesagt geht es dabei vor allem um die satztechnische Emanzipation akkordischer Prozesse, die als grundierende Flächen verwendet werden, sei es kontinuierlich wandernd oder voneinander abgesetzt.
Natürlich fragt man sich vorweg, wie eine so tragende Dimension der Wirklichkeit wie die Zeit befreit werden könne, noch dazu musikalisch, und woraus denn eigentlich. Würde man denn auch auf die Idee kommen, von einem befreiten Raum oder einer befreiten Materie zu sprechen? Wollen wir also zunächst weniger pathetisch von einer befreiten musikalischen Zeit sprechen, denn die ist ja tatsächlich erst in einer musikalischen Form herzustellen und kann so auch unter Umständen auch nicht bzw. nur eingeschränkt gelingen. Aber gerade diese Perspektive bleibt bei Schnebels Pathos auf der Strecke. Er geht aus von der verbreiteten Dichotomie von gemessener Zeit und zeitlichem Fluss, den auch er als die »eigentliche« Zeit bewertet und mit der »empfundenen« gleichsetzt – die Nähe zu Bergson ist unüberhörbar. Unverkürzte musikalische Zeit kann so von vorneherein nur die klangliche Materialisierung der fließenden Zeit sein, die von den Schemata der messbaren Ordnung befreit wäre und so in schöner Irrationalität einfach aus dem Inneren des Komponisten strömen würde. So wäre die Musik tatsächlich ein Befreiungsmedium der Zeit.
»Die solchermaßen komponierte – und empfundene Zeit ist nicht mit der gängig vorgestellten identisch. Solche wird von der Zeitmessung in Sekunden geprägt. Das Bild des gleichmäßig ablaufenden Sekundenzeigers affiziert die übliche Zeitvorstellung. In der Musik ist es der hörbare oder bloß gedachte Puls des Taktes, woran man sich orientiert. Nichtsdestoweniger wirkt Zeit leer, solange nichts sie akustisch strukturiert, und also wird musikalische Zeit vernehmlich erst als artikulierte, durch das, was in ihr geschieht.« (ders., S. 71)
Schnebel nähert sich hier durchaus einer formästhetischen Bestimmung musikalischer Zeit, ohne sie aber vollends einlösen zu können. Sein Zeitbegriff lässt seinem kritischen Hinweis auf musikalische Zeit klanglich strukturiertem bzw. artikuliertem Klang nur geringe gestaltästhetische Spielräume. Wir haben gehört, dass Zeit per se ein dialektisches Ineinander von offenem Fluss und hierarchischer Ordnung bzw. übergreifender Verschachtelung von Intervallfolgen darstellt. Lässt man die zweite Dimension weg, so bleibt im Extremfall nur die reine unterschiedslose Kontinuität, die nicht unterscheidbar ist von der der reinen Statik, oder die reine Fluktuation, also die bloße Folge immer anderer übergänglicher Veränderungen. Aber diese kann es nur zu einer vorgestaltlichen Reihung bringen, da die Veränderungsphasen keinen inneren Bezug zueinander besitzen. Wenn Schnebel gerade diese – in der Verwechslung von reiner Fluktuation mit entschematisierter Form – als Modell der musikalischen Befreiung von Zeit würdigt, so entspricht das seiner Disqualifikation der gemessenen Zeit als solcher. Komposition als gestalteter »Fluß der Klänge« wird von ihm gleichgesetzt mit »Anlagen von Fluktuationen wie von Impulsfolgen – […] [er] strukturiert Zeit selbst, formt sie gewissermaßen unmittelbar.« (ders., S. 71).
Wenn Schnebel hier (nicht ohne die immunisierende Einschränkung »gewissermaßen«) von Unmittelbarkeit spricht, so zeigt sich daran exemplarisch die fundamentale Verwechslung, die ihm in seinen Ausführungen immer wieder unterläuft: Er setzt Zeit naturalistisch mit einem konkreten, direkt greifbaren, Bewegungsfluss gleich. Wir haben aber gehört, dass die Zeit zugleich als konkretes und abstraktes Geschehen zu begreifen ist. Weder stellt sie ein rätselhaftes Fluidum oder gar eine subjektive Illusion jenseits konkret fassbarer materieller Bewegungen dar noch fällt sie mit diesen unmittelbar zusammen. Sie entfaltet sich in diesen als abstrakte Struktur mit ihren – um es nochmals zu wiederholen – beiden Dimensionen Reihenfolge und hierarchische Verschachtelung von Zeitintervallen. Dabei macht diese Strukturbildung, also die innere Gestalt-Koordination der prozessualen Segmente, gerade wegen der nichtidentischen Offenheit von Zeit auch die Möglichkeit ihrer chronometrischen Bezugnahme aufeinander erforderlich, sei es im Allgemeinen oder in der musikalischen Zeit. Daran lässt sich auch eine relativitätstheoretische Bestimmung musikalischer Autonomie anschließen. Eine musikalische Form ist in ihrer Zeitlichkeit immer auch zu verstehen als eine der autonomen Schichten im unendlichen Konzert der differenten Zeitabläufe der Wirklichkeit. Ihre Immanenz besteht auch in dieser Hinsicht nicht in einer Abkapselung von der außerkünstlerischen Welt, sondern in ihrer immanenten Bezugnahme auf diese.
Wenn Schnebel die abstrakte Dimension von Zeit als eine zeitfremde verdächtigt, von der sich die Musik befreien könne, so spricht er dabei eigentlich nicht von Zeit, sondern von konkreter Bewegung bzw. von spezifischen Bewegungstypen der Musik, wie sie sich nicht zuletzt bei Schubert emanzipiert haben. Dem entspricht seine Simplifizierung des Klangbegriffs, wenn er Schuberts befreite Zeit wie selbstverständlich als befreiten Klang charakterisiert. Da er dabei eine Befreiung der Musik insgesamt als Klangmedium geltend machen möchte, gehen ihm zwei Ebenen durcheinander, denn er spricht ja genau besehen nicht vom Erklingenden überhaupt, sondern vom Klang als einem spezifischen satztechnischen Begriff, von dem akkordhaften Aggregat mit seiner melodischen Oberlinie.
»In solchen Formen ist Zeit sozusagen [sic] direkt gestaltet. Was eigentlich geschieht, ereignet sich im Zeitablauf – und im Klang, da die musikalische Zeit gerade klanglich strukturiert wird. So liegen die eigentlichen Innovationen Schuberts denn auch in der Zeit – und in der Klangkomposition.« (ders., S. 81)
Aber die Emanzipation der Musik als Klangkunst ist nicht an diese spezifische Satzform gebunden, man kann sie genauso gut geltend machen für die hoch artikulierten motivischen Zusammenhänge bei Beethoven. Und sicherlich verdanken sich die genauestens ausgehörten Beethovenschen Formen in ihrer radikalen Individualität nicht weniger einem frei strömenden Inneren wie die Klang-Phantasien der Romantiker – E.T.A. Hoffmanns Beethoven-Kommentar der ersten Stunde, der noch vor dem Gerücht über den »Klassiker« Beethoven entstanden ist, hat dies unnachahmlich festgehalten. Umgekehrt bleiben Schnebel für seinen Begriff der musikalischen Form nur einfache Kombinationen aus bestimmen Bewegungstypen: Kompromissbildungen zwischen dem Ideal der beständigen Fluktuation, die nur zu gestaltlosen Veränderungen führen kann, einerseits und tektonisch artikulierten Prozessen andererseits – am Ende winkt denn doch der Baukasten trotz aller Bekenntnisse zum »Vegetativen«. Aber diese erwachsen auf dem Boden einer unverblümt ausgesprochenen Entgegensetzung von musikalischem Zeitfluss und Kompositionskunst, die am Ende bestenfalls einen einfachen Kompromiss zwischen beiden erlauben.
»Diese Musik fließt trotz [und nicht etwa wegen – man denke, um diesen Kontrast exemplarisch ermessen zu können, an die Orchesterwerke von Debussy. FZ] der artifiziellen Machart frei und locker dahin, als ob ihre Zeit keiner eingreifenden Gestaltung bedurft hätte. In manchen Passagen Schubertscher Werke […] treibt Zeit gänzlich naturhaft dahin […].« (ebd., S. 79)
Diesem Zeit-Naturalismus entspricht eine recht grobe Vorstellung musikalischer Form mit gereihten oder verzahnten Kontrasten. Schnebel verweist nicht zufällig darauf, dass
»das Verfahren der Zeitstrukturierung durch Klang montageähnliche Techniken [gestattet], indem in die vordisponierten Felder auch vorhandene Modelle eingesetzt werden können. In der Tat arbeitet Schubert oft mit sozusagen [sic] Vorgefertigtem.« (ebd., S. 82)
Form besteht hier aus einfachen Anordnungen von unterschiedlichen Bewegungstypen, wo sie sich nicht ohnehin, wie in den Liedern, auf einen einzigen beschränkt. Es gibt Kombinationen aus Kontinuität, Unterbrechung bzw. Störung, Kreisen, Auf-der-Stelle-Treten, Stau, Explosion, auch Steigerungen in der sukzessiven Verzahnung unterschiedlicher Bewegungen usw. Die Formbestimmung beschränkt sich in dieser Perspektive auf die bloße Oberflächenbeschreibung, da der Formbegriff darin ohnehin leicht aufgegeben wird. Das ersetzt die übergreifende Sinninterpretation, etwa beim 1.Satz der großen Klaviersonate B-Dur.
»Das ist Protokoll eines dissoziierenden Lebens, welches sich mehr tastend als zugreifend verhält; dem es nicht leicht mehr gelingt, Form zu finden […].« (ebd., S. 73)
Auch in der weiteren Interpretation des Satzes gibt es keine eingehendere Bestimmung des inneren Sinnbezuges der Segmente zueinander. Die Form reduziert sich auf ein Gehäuse für unterschiedliche Bewegungsarten. Über das Stichwort der Verunsicherung oder Auflösung alter konventioneller Sicherheiten kommt ihre summarische Betrachtung nicht hinaus.
»Schuberts kompositorisches Verfahren der Zeitstrukturierung betrifft nicht nur einzelne Teile, sondern ganze Zusammenhänge, zumal es weniger der Herstellung detaillierter Einheiten als vielmehr der Artikulation fortlaufender Vorgänge gilt. Die Gestaltung von stillstehender oder in sich kreisender Zeit in den Liedern […] war auf den Gesamtablauf gerichtet; und in der B-Dur-Sonate sind die Prozesse retardierender Zeit für den ganzen ersten Satz konstitutiv; die Momente des Innehaltens durchsetzen ihn insgesamt; machen ihn zu einem löchrigen Gebilde, wo aufgerissene Stellen und die zeitlich ebenso abgelegenen Störungen des dunklen Trillers die Form gliedern. Im Finale sind es die Einhalt gebietenden Töne, auch die jähen Pausen, die wie Pfähle und Inseln den Fluß der Zeit kennzeichnen – und zersetzen. Dadurch wird die lustige Musik der Rondoteile, aber auch der lyrische Episoden zum bloßen Versuch, zum mißlungenen Anlauf, eben munter zu sein oder gefühlvoll. Also ist ein Zeitverlauf strukturiert, dessen Kraft sukzessive gebrochen wird […].« (ebd., S. 80)
Noch einmal sei darauf verwiesen, dass auch dieses Brechen von Verläufen sich innerhalb von zeitlichen Strukturen abspielt, die als solche nicht gebrochen werden können und so auch eine ungebrochene Form erzeugen. Wenn es darin um die – kunstvolle – Artikulation von Auflösungsprozessen geht, so steht das auf einem anderen Blatt.
Exkurs zu einer kinetischen Ästhetik
Bleiben wir aber vor der weiteren Entwicklung der Dialektik von Zeitfluss und Zeitordnung – die ja nach der Bestimmung von Zeit als nichtidentischer Polyphonie je individueller Geschwindigkeiten mit ihrer Anforderung an das Zeitbewusstsein, sie innerlich durch chronometrische Koordination zu erfassen, als nächstes zur Eigenschaft der Irreversibilität zu kommen hätte – noch bei dem Thema der musikalischen Bewegungstypen. Dieses führt uns zu einem eigenen Bereich der Theorie der musikalischen Zeit, einer kinetischen Ästhetik. Schnebels Würdigung von Schuberts »Befreiung« des Klanges im Sinne bestimmter Satztypen ist zwar zeittheoretisch höchst ungenügend, hat aber den Blick auf die zentrale Bedeutung der konkreten Bewegung als Gegenstand für die Strukturierung musikalischer Zeit gelenkt. Mit Schnebel kann man zunächst von der Polarität zwischen klanglicher Kontinuität und Diskontinuität ausgehen. Diese spielte für die Arbeitsweise der sogenannten Wiener Klassik mit ihrem schnellen Wechsel diskreter Motivfiguren (»durchbrochene Arbeit«) noch eine weit geringere Rolle. Die kontinuierlich fließenden Akkordbänder von Schuberts Musik liefern hingegen natürlich immer auch die Möglichkeit für ihre abrupte Störung oder Unterbrechung, die fast leiblich empfunden wird, und darüber hinaus für ihre Stauung oder Umlenkung in eine sich – unter Umständen spiralförmig zuspitzende – Drehbewegung, wie etwa in dem Lied „Der Doppelgänger“.
Ausgehend von der Eigenart bestimmter Skalen lässt sich quer zu dieser Polarität von kontinuierlichem Fluss und den Möglichkeiten seiner Unterbrechung an die musikalische Gestaltung unterschiedlicher Gangarten denken. Zu der genannten Kinetik des Fließens, des Kreisens und des Verharrens kann man weitere Bewegungsformen hinzufügen, die zwischen den Polen der Fundamentbindung und der Schwerelosigkeit angesiedelt sind: das gerichtete schrittweise Gehen, das sukzessiv entgrenzende Gleiten und das richtungslose Schweben. Gerade die erste Bewegungsart besaß eine entscheidende Bedeutung für die Ausbildung autonomer musikalischer Formen, somit einer eigenlogischen musikalischen Zeit. Wir haben bereits von der Schlüsselrolle gehört, die der kadenzharmonisch fundierte musikalische Satz für diese gespielt hat. Diese resultiert aus zwei Qualitäten: (a) Einmal lieferte die Kadenzrahmung historisch zum ersten Mal die Möglichkeit einer harmonischen Bewegung mit einer inneren Gerichtetheit, in der die aufeinander folgenden Akkorde auf einer übergreifenden Entwicklungslinie auseinander resultieren. Sie besitzt ein Schritt-Fundament, auf dem der gerichtete Gang von einer Eröffnung (der Tonika oder der tonalen Fundamentstufe) zu einem übergreifenden Beschluss (im Quint-Schritt von der Dominante zur Tonika) möglich ist. Dazu gehört auch die Möglichkeit der schrittweisen Entfernung von der Tonika, elementar durch den Quintschritt nach unten von ihr aus zur Subdominante. Diese Entfernung ist aber von vorneherein bezogen auf die Möglichkeit der Rückkehr zur Basis mit einem beschließenden Schritt am Ende. Nicht zufällig hat diese schlussorientierte und so »schlüssige« Schrittfolge von vorneherein Spekulationen über die Möglichkeit einer musikalischen Logik ausgelöst. Zuvor gab es in der Kunstmusik, die wesentlich aus Vokalmusik bestand, nur die Reihung von Strophen und in der Instrumentalmusik nur die Abwechslung kleiner Gruppen. (b) Zu dieser neuartigen Schlüssigkeit der Kadenzharmonik kam die Fundierung des gesamten Satzes auf dieser. Ihre spezifische Tonleiter, die diatonische Skala, aus der die Melodik sich speist, stellt den linearen Ausdruck der drei zentralen Dreiklänge dar. Jeder ihrer Töne gehört einem dieser drei Akkorde an und ihr Gang gehorcht (mit seinen zwei gliedernden Leittonschritten) ihrer gerichteten Abfolge. Diese durchdrang so auch die Melodik als motivischen Entwicklungszusammenhang. (c) Schließlich konnte der Kadenzrahmen hierarchisch auf das Satzganze projiziert werden, das sich in der Sonate nun auch zu einer neuartigen entwickelnden Form autonomisierte. Diese wurde so zum initialen Exempel für die musikalische Raum-Zeit. Ihre verschiedenen Segmente sind immer auch bezogen auf eine harmonische, anfangs diatonische, Grundstruktur, im einfachsten Fall: Das Hauptthema steht im Tonika-Bereich (der auch ein Pendeln zwischen Dominante und bestimmender Tonika enthalten kann) seine intern beschließende Überleitung schreitet zum Dominantbereich, auf der dann der Seitensatz steht, die beschließende Schlussgruppe verbleibt in diesem Bereich, so dass die Rückkehr zum Anfang in der Wiederholung gleichzeitig den harmonischen Beschluss im Schritt von der Dominante zur Tonika liefert.
Die gerichtete musikalische Schrittbewegung der Diatonik stellt nicht nur die Ausgangsfolie des entwickelnden Komponierens dar, sondern gleichzeitig eine Bewegungsform, die Möglichkeiten der Entgrenzung bot – durch sukzessive Erweiterungen. Diese waren bald auch verknüpft mit skalären Änderungen, sei es mit einem erweiterten Gebrauch der diatonischen Skala, also etwa durch den fließenden Einbezug möglichst vieler Stufen (auch in der Berührung mit modalen Skalen) – man kann von der Melodisierung tonaler Zusammenhänge (auch in der Bassbewegung, vor allem bei Brahms) sprechen, deren weitgespannte Bögen eine kinetische Qualität eigener Art besitzen – oder eben durch Tendenzen ihrer Auflösung. Entspricht die Diatonik dem gerichteten Gang, so führt die Konzentration auf die Leittönigkeit in der Tristan-Chromatik zu einer immer weiter drängenden Gleitbewegung, die wie eine ozeanische Wellenbewegung empfunden wird, und vollzieht die Ganztonleiter ohne Leittonschritte einem Zustand des Schwebens, ja auch Ineinanderfließens ihrer Töne, in dem erstmalig die Differenz zwischen Skala und (aufgeblättertem) vieltönigem Aggregat aufgehoben wird. Analoges gilt für Ketten gleicher Intervalle, wie sie mit der aufsteigenden Quarte vollzogen wurden: Besitzt dieses Intervall als solches schon den Charakter einer sprunghaften Eröffnung (weswegen es gerne auftaktig verwendet wurde, man denke etwa an das Scherzo aus Schumanns Zweiter Symphonie oder auch an den Anfang von Beethovens Erster Klaviersonate in f-moll, an dem er gleichsam in sein Klaviersonatenwerk hineinstürmt), so potenziert sich dieser in der kettenförmigen Wiederholung zum kinetischen Eindruck des raketenhaften Aufstiegs ins Offene. Wie der Ganztonschritt gehört auch die Quart zu den ersten Intervallen, die miteinander zum Aggregat verbunden wurden. Diese beiden Aggregatformen können, als sinfonischer Cluster oder Klanggrund, jeweils auf ihre Weise den Eindruck der kosmischen Grenzauflösung erzeugen, wie man etwa in der Dritten Symphonie von Karol Szymanowski oder dem Prometheus von Alexander Skrjabin (mit einer Variante des Quartakkordes als Zentralklang, man kann hier fast von einer Mischung dieser beiden Aggregatformen sprechen) eindrucksvoll hören kann. Das gilt natürlich erst recht für die Halbtoncluster, mit denen die Orchestermusik der Sechziger Jahre neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnen wollte.
Die Dialektik von Kontinuität und Diskontinuität
Wir haben nun einen übergreifenden Bogen zu schließen und der Dialektik von Zeitfluss und Zeitordnung noch ein entscheidendes Moment hinzuzufügen. Wie schwierig diese zu fassen ist, konnte sogar noch bei Adorno gesehen werden, erst recht bei Schnebel. Im beiden Fällen machte die konsequente Würdigung der strukturellen Seite der Zeit Probleme. Im Falle von Adornos Mahler-Monographie wird der Vorschlag einer neuen Methode der musikalischen Analyse zwar, in dezidiertem Gegensatz zur akademischen Gleichsetzung von Form und vorgeordneter Tektonik, der individuellen Prozessualität musikalischer Form gerecht, aber nicht hinreichend in ihrer Strukturqualität. Wie so oft bei Adorno besteht auch hier die Tendenz, die Dimension des übergreifend gegliederten Ganzen unterschiedslos mit dem Begriff des vorgegebenen Schemas über Bord zu werfen, sodass die Form hier nur als Gegenstand einer nachzeichnenden Deskription statt einer rekonstruktiven Strukturanalyse behandelt wird. Über die Schwächen von Schnebels naturalistischem Begriff der musikalischen Zeit ist hier bereits genug gesagt worden.
Wir haben auf die relativistische Erkenntnis des pluralen, man kann sagen nichtidentischen, Charakters von Zeit hingewiesen und dabei bereits den inneren Bezug der sich gegeneinander bewegenden je autonomen Zeitabläufe bzw. »Geschwindigkeiten« (Piaget) auf die, für das Zeitbewusstsein letztlich nur chronometrisch zu fassenden, objektiven Strukturbeziehungen zwischen ihnen geltend gemacht. Dabei haben wir auch auf die Unvereinbarkeit des relativitätstheoretischen Zeitbegriffs mit dem Ideal der exakten, da eindeutigen, Messung einer von ihr unabhängigen Objektwelt verwiesen. Auch die Zeitmessung selbst unterliegt der Offenheit der Zeit mit ihrer Anforderung, Messungen immer neu zu koordinieren. Nun muss noch die Bedeutung der Zeit-Pluralität für die genuin zeitliche Qualität der Irreversibilität oder Offenheit gewürdigt werden. Es wurde bereits hingewiesen auf die Eingebundenheit von Zeit in die Dynamik materialer Bewegungen. Da diese je individuellen Charakter besitzen, stellt auch Zeit selbst als innere Logik von Abfolgen stets ein individuelles Geschehen dar. Adornos »materiale Formenlehre« liefert einen Versuch, diese Dialektik von Ablauf-Logik und konkreter Prozessualität auf das Feld der musikalischen Zeit zu übertragen. Dies muss nun allerdings noch systematisch ergänzt werden. Wie Piaget exemplarisch gezeigt hat, kann man von Zeit erst sprechen mit Blick auf die Relation differenter Abläufe in ihren strukturalen Bezügen zueinander. Krude gesprochen gäbe es keine Zeit in einer Welt, die nur aus einer einzigen konkreten Bewegung besteht, sondern nur deren blinde ordnungslose Dynamik, ein nicht weiter bestimmtes Nacheinander von Veränderungen. So setzt auch die autonomieästhetische Rede von der konkreten Individualität der musikalischen Werk-Zeit immer schon ihren Bezug auf eine plurale Welt differenter Zeit-Abläufe außerhalb von ihr voraus. Es sei daher nochmals bekräftigt, dass zur Autonomieästhetik zwingend der Gedanke des inneren Bezuges der Werke mit ihrer individuellen Gestalt auf Verhältnisse in der außerkünstlerischen Welt gehört. Was die Musik angeht, ist die Kategorie der »absoluten Musik« daher sinnlos.
Aus der konstitutiven Pluralität von Zeitabläufen mit ihren inneren Bezügen zueinander resultiert auch die Irreversibilität bzw. die unversiegbare Offenheit von Zeit. Da es keine absolute bzw. metaphyische Vor-Koordination der gegeneinander bewegten Zeitabläufe gibt, verlaufen diese unaufhörlich in einer nicht (vollständig) vorhersehbaren oder vorweg verfügbaren Folge von Überschneidungen, die als solche niemals die Möglichkeit der Reversibilität zulässt. Man nennt sie »Ereignisse« als die Träger des nicht ableitbar Neuen im Zeitablauf – dieses wäre ein weiteres Moment der Zeit als vollständiger Bewegung. Auch dafür gilt die Dialektik von Zeitfluss und Zeitordnung, die nun zu erweitern ist um die von Kontinuität und Diskontinuität, Altem und Neuem. Betrachten wir dafür die zunächst das Verhältnis zwischen den drei Zeitmodi: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Im Gegensatz zu den räumlichen Bewegungen gilt für die zeitlichen der beständige Eintritt neuer Ereignisse, also die Differenz zwischen neu und alt, Gegenwart und Vergangenheit. Das bedeutet: Der zeitliche Fluss enthält das Moment der Diskontinuität, da das Neue per se nicht aus dem Alten ableitbar bzw. in diesem noch nicht in all seinen Qualitäten enthalten ist. Auf die Zeitmodi übertragen: Die Gegenwart oder Präsenz steht als Moment der Diskontinuität quer zu dem Kontinuum von der Vergangenheit in den Möglichkeitsraum der Zukunft und nicht einfach nur, wie im herkömmlichen Bild des Nacheinanders, zwischen diesen beiden. Andererseits gibt es in unserer erfahrbaren Wirklichkeit kein absolut Neues, keine reine Plötzlichkeit. Jedes Neue besitzt immer auch rekonstruierbare innere Beziehungen zu einem Alten, aus dem jeweils ein Kontinuum in eine hypothetische Zukunft entworfen werden kann, es steht also immer auch im Fluss der Zeit. Man muss daher sagen: Das Ereignis stellt eine je neuartige Fortführung des Alten dar, das aus dem Alten allein nicht herleitbar ist. Das Ereignis als Schnittstelle zwischen einer alten und einer neuen Realität existiert so nicht als in sich geschlossene Entität (wie es etwa die Rede von Einzelereignis suggeriert), sondern stellt selbst einen prozesshaften, daher nicht fest greifbaren Übergang dar. Da stets neue Ereignisse auftauchen, kann man im Prinzip den Fluss der Zeit als einen unaufhörlichen Übergang vom Alten ins Neue bezeichnen, der kein reines Kontinuum darstellt, sondern eine Folge unendlich kleiner diskontinuierlicher Schritte.
Wie aber ist dieses widersprüchliche Ineinander von Diskontinuität und Kontinuität im Ereignis zu erklären. George Herbert Mead hat darauf verwiesen, dass vergangen nicht mit abgeschlossen verwechselt werden darf. Die Vergangenheit besteht nicht nur aus der Menge früherer bzw. nicht mehr existenter Vorgänge. Diese haben immer auch subkutane Möglichkeiten enthalten, die nicht zur manifesten Entfaltung kamen, aber rückwirkend aus der diskontinuierlichen Perspektive einer neuen Situation auf eine bis dahin nicht mögliche Weise erfasst und weiterentwickelt werden können. Im Lichte dieser neuen Perspektive verändert sich die Bedeutung der Linie der Vergangenheit insgesamt, damit auch das Bild der Zukunft, in das die je neue Rekonstruktion der Vergangenheit hypothetisch verlängert werden kann. Walter Benjamin hat diesen beweglichen Charakter der Vergangenheit in den Mittelpunkt seiner Thesen über Geschichte gestellt. (Benjamin, 1992). So absurd es wäre, die Zeit-Modi als solche in Abrede zu stellen, so wenig sind sie fest gegeben. Es existiert weder eine stabil greifbare Gegenwart noch die Vergangenheit noch die Zukunft. Weder stellt die Zeit eine bloße Reihung von Ereignissen dar noch einen beständigen Ableitungsprozess noch eine auf eine vorgesetzte Zukunft hin gerichtete Teleologie. Nicht nur gibt es eine immer neue Gegenwart, sondern verändern sich auch Vergangenheit und Zukunft beständig, aber eben in einer immer neu zu rekonstruierenden übergreifenden Kontinuität. Sucht man einen Strukturbegriff dafür, so wäre es der der nichtlinearen Entwicklung.
Musikalische Zeit als nichtlineare Entwicklung
Eben um diese geht es auch in der Bestimmung der musikalischen Zeit. Marcel Proust hat sie auf scharfsinnige Weise an der musikalischen Rezeption herausgearbeitet. Er beschreibt, wie diese einerseits offen von einem musikalischen Ereignis zum nächsten verläuft, dabei aber andererseits zurückbeugt ist in einer immer wieder neuen rekonstruktiven Synthese des jeweiligen Verlaufs. Die Bewegung ins Offene hinein wird also auch bei ihm erkennbar als mikrologische Schrittfolge im kontinuierlich gespeisten Aufbau eines musikalischen Zusammenhangs und nicht adoriert als reiner Fluss. Proust erweist sich auch hier keineswegs als jener Schüler von Bergson, zu den man ihn immer wieder gerne gemacht hätte. In einer der berühmtesten Passagen aus der »Suche nach der verlorenen Zeit«, »Unterwegs zu Swann«, beschreibt er, wie das Hören von Swann sich immer wieder aus flüchtigen Eindrücken in eine innerlich festgehaltene graphische Transkription des jeweiligen Verlaufs verwandelt, wie je aktuelle Eindrücke immer erst im Gedächtnis Festigkeit gewinnen, während schon wieder neue Eindrücke aufgefasst werden (was eindrücklich bestätigt werden kann durch Ulric Neissers »Kognitive Psychologie« mit ihrem Begriff des »transitorischen ikonischen Gedächtnisses«, s. Neisser, 1974, S. 35f.), und wie diese Transkriptionen sich sukzessive zu einem stabilen Gestaltraum verfestigen.
»Von einem gewissen Augenblick an aber hatte er, ohne daß er, was ihm eigentlich gefiel, deutlich sich abzeichnen sah oder hätte benennen können, wie verzaubert das Thema oder die Harmonie […] festzuhalten versucht, die an sein Ohr drang und ihm die Seele auftat […]. Ein Eindruck dieser Art ist einen Augenblick lang sozusagen ›sine materia‹. Zweifellos neigen die einzelnen Töne, die wir hören, […] Arabesken zu beschreiben, Empfindungen von Breite, Schmalheit, Massivität oder spielerischer Leichtigkeit zu vermitteln. Doch die Töne sind schon verrauscht, bevor noch die Empfindungen in uns so deutlich geworden sind, daß sie nicht von denen überflutet worden sind, die aus den folgenden oder sogar schon zu gleicher Zeit Erklingenden entstehen. Und dieser Eindruck würde auch weiterhin mit seinem Fließen und seinen ›Abtönungen‹ die Motive umhüllen, die sich für Augenblicke und kaum sichtbar darüber erheben, um gleich wieder unterzutauchen und darin zu verschwinden […], unmöglich jedoch zu beschreiben oder zurückzurufen, zu benennen, ganz unsäglich mithin – wenn nicht [kursiv durch FZ] das Gedächtnis, wie ein Arbeiter, der inmitten der Flut ein dauerhaftes Fundament zu errichten sucht, indem er für uns von diesen flüchtigen Takten ein Faksimile herstellt, es uns ermöglichen würde, sie mit den darauffolgenden zu vergleichen und von ihnen zu unterscheiden. […] [Swann] hielt [den Eindruck] sich jetzt gleichsam graphisch dargestellt in seinem Ausdruckswert vor [Augen] und hatte damit schon etwas in der Hand, was nicht mehr reine Musik war, sondern Zeichnung, Architektur, etwas Gedankliches, mit dessen Hilfe es möglich ist, sich an Musik zu erinnern.« (Proust, S. 304f.)
Adorno hat diesen Vorgang auf die kurze Formel gebracht:
»Während [der Hörer] dem Verlauf [der] Musik spontan hört folgt, hört er das Aufeinanderfolgende: vergangene, gegenwärtige und zukünftige Augenblicke so zusammen, daß ein Sinnzusammenhang sich herauskristallisiert.« (Adorno, 1975, S. 18)
Es ist wichtig zu sehen, dass Proust hier nicht von einer äußeren Überformung musikalischer Eindrücke durch ihre sukzessive Subsumtion unter starre Gerüste spricht, sondern von einer innermusikalischen Transformation des reinen Klanggeschehens in die visuell verwandelte Gestaltspur seines inneren Zusammenhangs. Bei dieser handelt sich zwar nicht mehr um »reine Musik«, aber dennoch um die Repräsentation einer inneren Dimension von Musik. Adornos »materiale Formenlehre« wäre der Versuch, diese Transformation auf die Ebene der theoretischen Explikation zu haben. Lévi-Strauss hat dieses Verhältnis der Aufhebung in der Beziehung zwischen der Theorie und der Eigenbewegung des Mythos geltend gemacht – mit Piaget kann dabei von »reflektierender Abstraktion« sprechen.
»Und indem unser Unternehmen […] die spontane Bewegung des mythischen Denkens nachvollziehen wollte, mußte es sich seinen Anforderungen beugen und seinem Rhythmus fügen. So ist dieses Buch über die Mythen in seiner Weise auch ein Mythos.« (Lévi-Strauss, 1976, S. 17)
Neue Musik: paradoxes Komponieren jenseits der musikalischen Zeit
Mit der Kategorie der nichtlinearen Entwicklung lässt sich die musikalische Form zeittheoretisch von einer statischen Architektonik unterscheiden. Der musikalische Zusammenhang wird so fassbar als eine gestaltete Repräsentation von Zeit: als gestalthafte Folge mikrologischer Schritte in der offenen Aufschichtung eines übergreifend gegliederten Ganzen. Theoretische Kategorien für solche Schrittfolgen sind einstweilen nicht in Sicht, sie setzen neuartige Methoden der interpretativen Strukturanalyse von Musik voraus.
Wir wollen an dieser Stelle eine kompositorische Paradoxie der musikalischen Zeit in den Blick nehmen, die nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre lang konsequent ausgetragen wurde – wobei die Motive dafür an anderer Stelle genauer beleuchtet werden sollen. Bereits Baudelaire hat im »Maler des modernen Lebens« auf einen unschlichtbaren Widerspruch in der autonomen künstlerischen Produktion, hier im Falle Malerei, hingewiesen, der mit dem bloßen Verweis auf ihre Dialektik nicht abgetan werden kann.
»Es entsteht […] ein Widerspruch zwischen dem Willen, alles zu sehen, nichts zu vergessen, und dem Vermögen des Gedächtnisses, das sich gewöhnt hat, die vorherrschende Farbe und die Silhouette, die Arabeske des Umrisses lebhaft in sich aufzunehmen. Ein Künstler, der über ein vollkommenes Formgefühl verfügt, jedoch die Gewohnheit angenommen hat, vor allem sein Gedächtnis und seine Vorstellungskraft zu üben, sieht sich dann gleichsam einer aufrührerischen Menge von Details ausgesetzt, die allesamt mit der Wut einer nach absoluter Gleichheit lechzenden Menge ihr Recht fordern. Dabei wird alle Gerechtigkeit unweigerlich verletzt, jede Harmonie zerstört, geopfert. […] Je unparteiischer der Künstler sich der Einzelheiten annimmt, um so mehr wächst die Anarchie. Er mag kurzsichtig oder weitsichtig sein, jede Hierarchie und jede sinnvolle Unterordnung verschwinden.« (Baudelaire, 1989, S.230)
Wenn Baudelaire hier einerseits von den Rechten der aufrührerischen Details auf individuelle Autonomie spricht, andererseits von ihrer gerechten Behandlung im Sinne einer übergreifenden Harmonie, so wird in diesem Konflikt der Rechte, bei aller Parteinahme für den Formkünstler, ein unlösbares Problem in der Autonomisierung des Werkes thematisch. Einerseits verlangt diese eine immer stärkere Einbeziehung der autonomen Details bzw. einen immer größeren ästhetischen Detail-Reichtum, in dem am Ende jede ästhetische Qualität das Recht auf künstlerische Behandlung besitzt – man denke in der Musik etwa an die Rebellion von Varèse gegen den reinen Orchesterklang –, andererseits aber gegenläufig dazu eine immer höhere Dichte des inneren Zusammenhangs – man denke hierbei etwa an die beiden Klarinettensonaten op. 120 von Brahms. Jeder der Autonomisierung gegenüber verpflichtete Komponist sah sich spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts diesen beiden nicht konsequent miteinander vereinbaren Anforderungen gegenüber, was sich etwa in den komplementären Sottisen über die daraus erwachsenden beiden Parteien zeigt: Adornos abschätzige Bemerkung, es gäbe bei Wagner kein Geheimnis der Form, da es eben auch keine Form gäbe, entspricht dem Spott über die Einfallslosigkeit in den Sinfonien von Brahms – umso wohltuender dabei die Ausnahmen, etwa die emphatische Wertschätzung von Brahms durch Charles Ives.
In der Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg führte diese objektiv geforderte, aber gleichzeitig nicht realisierbare Doppelseitigkeit zum Paradox eines Komponierens jenseits des Komponierens, mit einer polaren Zerstörung der musikalischen Zeit. Wie bereits angemerkt, werden die Motive dafür, das durchzuspielen, an anderer Stelle behandelt. Insgesamt ist hier eine Abwehr gegen den weiteren Austrag der Dialektik von emanzipierten Details und innerem Zusammenhang im Rahmen einer bindenden Gestalthierarchie zu bemerken, da sie als unglaubwürdig verdächtigt wird. Die Bemühung um eine Maximierung der inneren Beziehungen zwischen den musikalischen Elementen verselbständigte sich stattdessen durch eine vollständige Formalisierung des Komponierens, exemplarisch im Serialismus. Die totale Vorstrukturierung musikalischer Prozesse führte hier (zunächst) zu einer Aufhebung der Dialektik von Struktur und Ereignis. Die höchst differenzierte Zersplitterung der Musik in nur noch mathematisch miteinander verbundene Einzelelemente stellte lediglich an der Oberfläche eine Folge diskontinuierlicher Ereignisse dar – man kann von einen trügerischen Ereignisschein sprechen, da es sich hier ja um eine vorweg konstruierte Diskontinuität handelte. Anders gesagt: Die Klangsplitter stellen nur abstrakte Elemente eines von Anfang an festgelegten Konstruktionsplanes dar. Die musikalische Zeit wird so zum bloßen Ablauf eines synchronen Formalismus, sie verliert also mit ihrer Offenheit auch die Qualität der Irreversibilität – man könnte im Prinzip ein seriell völlig durchorganisiertes Stück im Prinzip auch von hinten spielen. Dass der Serialismus sich ziemlich schnell kompositorisch selbst überstieg, steht auf einem anderen Blatt.
Die gegenläufige Entwicklung des Komponierens, also die Maximierung einer offenen Vielfalt von Elementen, zeigte sich auf verschiedene Weise. Das Moment des ungerasterten, undomestizierten, Klangreichtums wurde zum höchsten Ideal der Environment-Ästhetik, die die unendliche ästhetische Vielheit der außerkünstlerischen Wirklichkeit zum Vorbild hatte. Dazu gehörte etwa schon früh das Stück 4’33“ von John Cage. Dieses besteht nur aus dem im Titel genannten Zeitrahmen (bei der Uraufführung von einem Pianisten am Konzertflügel markiert) und den darin sich zufällig ereignenden akustischen Vorkommnissen, die in ihrer rein ästhetischen Qualität aufzufassen sind. Aber auch diese extreme, von keinem Publikum erfüllbare, Steigerung des reinen Hörens verliert die musikalische Zeit. Gibt es in der totalen Vorstrukturierung keine Offenheit und damit keine Ereignisse mehr, sondern nur noch mechanische Abläufe, so besteht die totale akustische Offenheit nur noch in einem beliebigen Nacheinander oder Wechsel von Elementen, was ebenfalls zu einem Ausfall der Ereignisdimension führt. Wir haben ja gehört, dass genuine Ereignisse je neue, nicht vorweg ableitbare Übergänge in Entfaltungslinien darstellen. Wir haben es bei Cage also auch nicht mit individuellen bzw. »freigelassenen« Momenten zu tun, sondern mit voneinander isolierten. Cage hat diesen Isolationismus auch auf extrem konstruktivistische Weise herzustellen versucht. Für sein Klavierwerk Music of Changes verwendet er eine Reihe von Tabellen, die jeweils ein Sortiment ganz bestimmter Materialelemente enthalten, also Tabellen mit Dauern- und Lautstärkewerten, Anschlagsarten, klanglichen Elementen, die er ihrerseits aus Improvisationsmaterial ausgewählt hatte, usw. Cage kam es darauf an, die gesamte Abfolge der Klänge des Stückes durch die zufällig erzeugte Kombination von Elementen aus den verschiedenen Material-Tabellen zu erzeugen. Als Zufallsgeneratoren dienten ihm Würfel und daneben Spiel-Karten. Die jeweils ermittelten Werte entsprachen bestimmten Zellen in den durchnummerierten Tabellen mit dem daraus zu wählenden Materialelementen. Ein erwürfelter rhythmischer Wert wurde mit einem erwürfelten Dauernwert, einer erwürfelten Anschlagsart usw. zu einem konkreten Klang kombiniert, und das in Folge immer wieder neu, bis am Ende ein vierteiliges dreiviertelstündiges Klavierwerk herauskam – das im Übrigen, wie im Frühwerk von Cage, noch eine mathematisch ausgezirkelte Vor-Gliederung besitzt. So werden, um nur einen schnellen Eindruck zu geben, insgesamt 29 5/8 »Struktureinheiten« auf die Vier Hefte des Stückes verteilt: für das erste 3, für das zweite 11 3/4 (= 5 + 6 3/4), für das dritte 6 3/4 und für das vierte 8 1/8 (= 5 + 3 1/8) Einheiten. Man erkennt bereits daran eine Verklammerung von Heft I und III (je eine Großstruktur) und von Heft II und IV (je zwei Großstrukturen). Andererseits sind Heft I und II zusammen annähernd gleich lang wie Heft III und IV miteinander (14 3/4 und 14 7/8 Einheiten). Es ist bemerkenswert, mit welch pedantischer Akribie die Zufallswelt dieses Stückes zusammengebaut wurde. Wenn dabei an die Stelle individueller Momente, zu deren Individualität natürlich auch ihr je unvertauschbarer Bezug auf das Ganze gehören würde, nur vertauschbare isolierte Momente gesetzt werden, gibt es auch keinen offenen Zeitverlauf mehr, sondern gar keinen. An Stelle einer musikalischen Zeit tritt ein zeitfremdes Nebeneinander von Klangelementen, und an die Stelle des Erlebens einer extremen ästhetischen Fülle tritt eine abstrakte Negativ-Erfahrung: der leere Eindruck von Nicht-Zusammenhang. Da die Zeit des Stückes nicht mehr musikalisch gestaltet ist, wird es unverwüstlichen chronometrischen Zeit überantwortet, was von der Cage-Apologie wunderlicherweise als kompositorische Revolution verkündet wurde (vgl. Schädler, 1990), denn noch nie hätte es dies vorher je gegeben.
Es fiel schnell auf, dass die Konstruktion von totalem Nicht-Zusammenhang im Gestalt-Resultat der Konstruktion von totalem Zusammenhang sehr gleicht, man kann bei manchen Passagen sogar von täuschender Ähnlichkeit sprechen – und es ist auch kein Zufall, dass herausragende Protagonisten dieser beiden Richtungen, vor allem Cage und Boulez, zeitweise hohes wechselseitiges Interesse füreinander gezeigt haben, etwa, was die konstruktive Rolle von Tabellen anging. Beide Seiten hatten auch mit derselben Sackgasse der Gestaltvermeidung zu kämpfen. Ihr gemeinsames Ansinnen, die für die Tradition konstitutive Dimension der übergreifenden Formgestaltung auszuschalten, brachte sie, soweit es über eine Gliederung in Abschnitte hinausging, in eine schmale residuale Position der bloßen »Vermeidung von«. Eine höchst missliche Folge davon war, dass mit dem neuen Satzbild aus Mengen voneinander isolierter Elemente schnell eine neue Stereotypie geschaffen wurde, die für das Selbstverständnis, mit jeder Konvention aufzuräumen, desaströs war.
»Das total Determinierte wird dem total Indeterminierten gleich. Hierin ist der erwähnte Parallelismus zwischen integral-serieller Musik und jener vom Zufall regierten von Cage zu suchen. Bezeichnend für beide Typen ist der folgende Habitus: Pause – Ereignis – Pause – Ereignis – Pause und so weiter.« (Ligeti, 2007, S. 92)
Da wir nun auch wissen, dass man hier nicht strengen Sinnes von »Ereignissen« sprechen kann, reduziert sich das musikalische Geschehen so auf eine – mögen sie auch formal total vorgeordnet sein – ästhetisch ungeordnete Menge von Elementen, die natürlich keine musikalische Zeit kennt.
Auch wenn die Frage nach den Motiven für diese Vorgehensweise hier nicht genauer behandelt werden soll, muss doch das Bild von ihr vervollständigt werden. Es handelt sich hier nicht bloß um eine gestaltästhetisch unbekümmerte Technokratie des Material- und Konstruktionsfortschritts, um eine »fröhliche leere Fahrt« (Adorno, 1956, S. 137), auch wenn die Protagonisten zu diesem Bild selbst viel beigetragen haben. Die Ausblendung der Form-Dimension bedeutete keinen Monismus der technischen Verfahren, sondern vielmehr den vergeblichen Versuch, eine leitende ästhetische Idee oder eine Vision, um es so zu nennen, direkt zu artikulieren, ohne intermediäre Form. Diese schien eine nicht mehr glaubwürdige, ideologisch belastete Vorstellung der übergreifenden Gestaltbildung geworden zu sein. Cage etwa folgte hingegen einer von allen ästhetischen Konventionen befreiten Allklang-Musik. Darin sind die Pole des musikalischen Environments und der Zufallskonstruktion miteinander verbunden, der Begriff des Zufalls wird in dieser Perspektive nachgeordnet und erst so ästhetisch relevant. Stücke wie die Music of Changes können so als Felder und nicht bloß als Mengen isolierter Elemente wahrgenommen werden, mit einer Aufhebung des Zeitbewusstseins durch gleichschwebende Aufmerksamkeit. Stockhausen ging davon aus, dass mit den neuen Mitteln der integralen Konstruktion erstmalig Gebilde aus völlig gleichberechtigen Elementen herstellbar waren, die ohne Kanalisierung durch übergeordnete Gestalthülsen in direkter Berührung mit den mikro- und makrologischen Strukturen der Schöpfung stehen würden. Das klingt bisweilen weit eher nach mittelalterlicher Theologie als nach Bastel-Lust. Die musikalische Konstruktion sieht sich hier gespeist aus einer geistigen Verbindung mit der kosmischen Ordnung. Aber bereits in den Anfangs-Texten zum Serialismus meldet sich auch die Gestaltforderung wieder, die bald in der Wende zur »Gruppen-Komposition« erste Konsequenzen zeigen wird.
»Zu denken geben sollte dies, daß man alle natürlichen Erscheinungen, die wir kennen, auf mikroskopische Weise betrachten kann und man überall den geordneten Zusammenhang von Atom- und Molekülkräften entdeckt. Daß aber alle übergeordneten Erscheinungen, alle ›Gestalten‹, in einem ebensolchen Ordnungszusammenhang stehen. Daß eben der Ordnungszusammenhang in der Natur ein universeller, allgegenwärtiger ist. Eine Musik, die langweilig und scheußlich klingt, in der man auch bei aufgeschlossenstem Hören keine übergeordneten Zusammenhänge, keine Formierung im kleinen wie im großen spürt, ist schlecht gebaut, wenn sich der Komponist auch noch so sehr auf die innersten Tonzusammenhänge berufen mag. […] Weil man mit den überlieferten Formvorstellungen nichts mehr anfangen kann, so ist es gerade darum die Aufgabe, nicht nur auf den Ablauf eines Reihensystems oder irgend eines anderen Systems überhaupt zu achten – es auch noch so ›ideell‹ begründet –, sondern sich Rechenschaft zu geben über die Zusammenhänge von serieller Tonordnung nd klanglicher Erscheinung, von klanglicher Einzelerscheinung und den aus dem Zusammenhang von solchen Einzelerscheinungen resultierenden Gestaltformen.« (Stockhausen, 1963, S. 59f.)
Das Kunstwerk jenseits von Entstehen und Vergehen
Sowohl bei Cage als auch bei Stockhausen blitzt hier ein zentrales zeittheoretisches Motiv auf, die Aufhebung der Vergänglichkeit im ästhetischen Schein des Werkes. Wir sprachen von der Möglichkeit des meditativen Versinkens in die vorattentiven Allklang-Felder von Cage, in denen der Zeitverlauf aufgehoben zu werden scheint. Im frühen Serialismus ging es um die Wahrnehmung reiner, zeitloser Strukturen im geschichtslosen oder geschichtenlosen Wandel ihrer Erscheinung.
Um das Verhältnis von Kunst zur Vergänglichkeit noch genauer zu fassen, blicken wir ein letztes Mal auf die Eigenschaften der Zeit im Allgemeinen zurück. Man kann in ihrem konstruktiven Fortlauf zwei gegenläufige Richtungen feststellen. In der einen ereignet sich fortlaufend Neues, wird Bestehendes so immer weiterentwickelt – das ist der in die Zukunft weisende Pfeil des Entstehens. In der anderen Richtung sinkt in jedem Moment gerade Entstandenes in die Vergangenheit zurück, da es sofort einem Neuen den Platz frei machen muss – das ist der zurückweisende Pfeil des Vergehens. Entstehen und Vergehen sind Kehrseiten derselben Medaille.
Die Kunst kann auf besondere Weise damit umgehen, wie man exemplarisch von Marcel Proust erfahren hat. Dies liegt an dem ästhetischen Charakter des diskontinuierlich Neuen, durch das die Kontinuität von Entstehen und Vergehen immer wieder aufgebrochen wird. Wenn Proust von der wiedergefundenen Zeit spricht, so ist damit, worauf Samuel Beckett in seiner frühen Proust-Studie entschieden verwiesen hat, eigentlich das künstlerische Finden der Zeitlosigkeit gemeint (Beckett, 1960, S. 62). Man kann hier von der Paradoxie einer momentanen Ewigkeit sprechen, die Ludwig Wittgenstein so genial bestimmt hat:
»Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt.« (Wittgenstein, 1984, S. 84)
Das Werk richtet sich darin ein und lässt den Leser daran teilhaben. Proust verweist auf die einzigartige Qualität von Kunst, unwillkürlich erinnerte Momente glückversprechender Erfahrungen in einer zeitlosen geistigen Sphäre miteinander kommunizieren zu lassen. In der Unwillkürlichkeit der künstlerischen Erinnerung werden die ästhetischen Qualitäten des Erinnerten als entrückte Welt einer ganz eigenen Erfüllung ungefiltert erfasst und dabei zum Material geistiger Konstruktionen gemacht, etwa in der Form des Romans. Natürlich befinden wir uns hier in der Sphäre des künstlerischen Scheins, da das glückvoll Erinnerte sich niemals ausschließlich als ästhetisches Geschehen abgespielt hat und in voller Realität recht belanglos sein konnte. Adorno hat diese Einsicht ins Zentrum seiner Mahler-Monographie gestellt.
»An der Utopie hält Mahlers Musik fest in den Erinnerungsspuren der Kindheit, die scheinen, als ob allein um ihretwillen zu leben sich lohnte. Aber nicht weniger authentisch ist ihm das Bewußtsein, daß dies Glück verloren ist und erst als Verlorenes zum Glück wird, das es so nie war.« (Adorno, 1986, S. 287)
Aber dennoch dürfen wir in der immer auch sinnlich evozierten künstlerischen Phantasie für kurze Zeit an jener Befreiung von aller Vergängnis partizipieren, die der Augustinus exemplarisch als die tiefste Sehnsucht unserer irdischen Existenz ausgesprochen hat.
»Jetzt […] vergehen meine Jahre unter Stöhnen, doch du, Herr, mein Trost, mein Vater, bist ewig. Ich hingegen, ich zerrinne in den Zeiträumen, deren Abfolge ich nicht kenne. Meine Gedanken, also die innersten Eingeweide meiner Seele, werden zerfetzt vom Aufruhr der Mannigfaltigkeiten – bis mein Lebensstrom gereinigt in dir zusammenfließt, flüssig geworden im Feuer deine Liebe.« (Augustinus, 1989, S. 30f.)
Literaturverzeichnis
Adorno, Theodor W. (1956): Das Altern der neuen Musik, in: ders., Dissonanzen (S. 136-153). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Adorno, Theodor W. (1975): Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Adorno, Theodor W. (1986): »Mahler. Eine musikalische Physiognomik«, in: ders., Die musikalischen Monographien (S. 149-319). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Adorno, Theodor W. (2003): »Form in der neuen Musik«, in: ders., Musikalische Schriften I-III (S. 607-627). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Augustinus (1989): Bekenntnisse. Stuttgart: Philipp Reclam jun.
Baudelaire, Charles (1989): »Der Maler des modernen Lebens«,, in: ders: Werke. Band 5 (S. 213-258). München, Wien: Hanser.
Beckett, Samuel (1960): Proust. Zürich: Die Arche.
Benjamin, Walter (1992): »Über den Begriff der Geschichte«, in: ders., Sprache und Geschichte. Philosophische Essays (S. 141- 154). Stuttgart: Reclam.
Herder, Johann Gottfried (1998): Band 8. Werke in zehn Bänden (hrsg. von Hans Dietrich Irmscher). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Lévi-Strauss, Claude (1975): Strukturale Anthropologie II. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Lévi-Strauss, Claude (1976): Mythologica I. Das Rohe und das Gekochte. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Ligeti, György (2007): »Wandlungen der musikalischen Form«, in: ders., Gesammelte Schriften. Band 1. hrsg. von Monika Lichtenfeld) (S. 85-104). Mainz: Schott.
Mead, George Herbert (1969): Philosophie der Sozialität. Aufsätze zur Erkenntnisanthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Neisser, Ulric (1974): Kognitive Psychologie. Stuttgart: Ernst Klett.
Piaget, Jean (1974): Die Bildung des Zeitbegriffs beim Kinde. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Proust, Marcel (2017): Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Band 1, Band 7. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Schnebel, Dieter (1979): »Auf der Suche nach der befreiten Zeit«, in: Musik-Konzepte Sonderband Franz Schubert (S. 69-88): München: edition text + kritik.
Schädler, Stefan (1990): »Transformationen des Zeitbegriffs in John Cages Music of Changes«, in: Musik-Konzepte Sonderband John Cage II (S. 185-236). München: edition text + kritik.
Stockhausen, Karlheinz (1963): »Zur Situation des Metiers (Klangkomposition)«, in: ders.: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik. Band 1 (S. 45-62). Köln: Dumont Schauberg.
Wittgenstein, Ludwig (1984): Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe Band 1. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Zehentreiter, Ferdinand (2022): Operation und Ereignis. Ein relativitätstheoretischer Begriff der sozialen Zeit. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
[1] Der Text enthält erste Überlegungen zu dem in Entstehung begriffenen Band »Musikalische Zeit. Eine relativitätstheoretische Perspektive« (Velbrück Wissenschaft, 2025), der seinerseits versucht, das Zeitmodell des Autors (»Operation und Ereignis. Eine Relativitätstheorie der sozialen Zeit«, Velbrück Wissenschaft, 2022) auf die Musik zu übertragen.
